Mediation im Jahre 2025 - Auslaufmodell oder Durchstarter? Zu den Zukunftsaussichten der Mediation.
INKOVEMA-Roundup 2025 (#10)
In den europäischen Friedenszeiten der Nuller- und Zehner-Jahre, in denen Mediation EU- und nationalstaatlicherseits intensiv finanziell und ideel gefördert wurde, hat die Mediation leider nicht den erhofften Status einer „üblichen Alternative“ zum Gericht erlangt.
Jetzt, wo Krieg wieder in (West-)Europa Einzug gehalten hat und die staatliche Förderung abebbt sowie aggressive, machtbasierte Konfrontationsstrategien (wieder) salonfähig geworden sind, was meinen Sie, hat die Mediation Ihre beste Zeit hinter sich oder erhält sie womöglich gerade dadurch in der Praxis den Zuspruch, den sie sich seit jeher erhofft und beansprucht hat?
Was sind für Sie die maßgebenden Gründe?
Lesen Sie die Antworten von Mediations-Expert*innen nachfolgend.
Wir von INKOVEMA stellen seit 10 Jahren jährlich eine grundlegende Frage zur Mediation. Grund genug für uns, den Blick gen Horizont zu wenden und die Aussichten für die Mediation zu erfassen. Wir sind dankbar für die Einsendungen und haben uns infolge der unterschiedlichen Antworttendenzen dazu entschieden, alle Antworten ungekürzt zu veröffentlichen.
Liebe Leserin und lieber Leser, wir würden uns freuen, wenn Du Dir die Zeit nimmst, auch Deine Aussichten und gern auch Deine Reaktionen, Gedanken und Gefühle, die die vorliegenden 14 Antwortenden bei Dir ausgelöst haben, uns allen in den Kommentaren zur Verfügung stellst.
Dr. Alexander Redlich
Hamburg
Psychologe und Berater
Universität Hamburg (Professor im Ruhestand)
Mitherausgeber der KonfliktDynamik
Website: Webauftritt Universität Hamburg
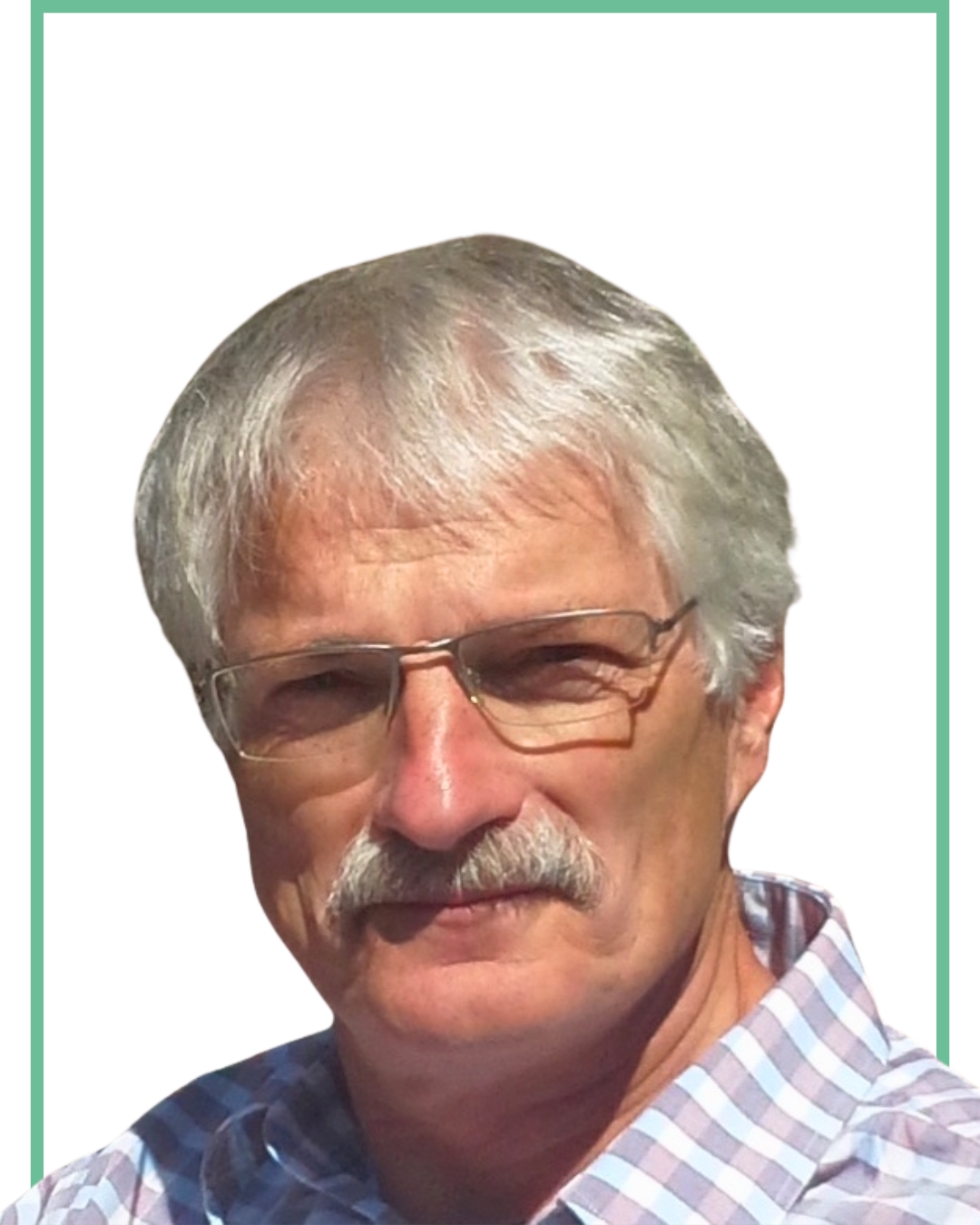
Mediative Konfliktvermittlung war in allen Zeiten wichtig. Sie hat gute und schlechte Zeiten hinter sich – und vor sich. Das gilt für alle verschiedenen Lebensbereiche: für die große und kleine Politik wie in privaten Organisationen, bei Familien- und Nachbarschaftsstreitigkeiten. Schlechte Zeiten bieten die Chance, Mediation situationsgerecht zu optimieren. Dazu sollte man das eigene Konzept kritisch reflektieren und sich fragen, was man in den vergangenen Jahren nicht genügend berücksichtigt hat, in welchen Aspekten man manche Menschen nicht erreicht hat, und was man in Zukunft angehen sollte.
Ich habe mein verständigungsorientiertes Konzept von Mediation im Hinblick auf die Annehmbarkeit durch potenzielle Konfliktparteien kritisch überdacht und komme dabei zu verschiedenen Punkten, von denen ich hier einen in den Fokus nehme; das grundlegende Dilemma von beziehungsförderlicher („höflicher“) Verständigungshaltung und (riskanter) emotionaler Wahrhaftigkeit.
In den 80er und 90er Jahren habe ich bei meiner Konfliktarbeit in Gruppen zu wenig Erfahrungen mit schwerwiegenden Konflikten gemacht. Außerdem habe ich überwiegend in akademisch gebildeten Kreisen mediativ gearbeitet. Dort kam ich zwar gut an und entwickelte eine hochdifferenzierte, achtsame Sprache. Eine einfache, prägnante Ausdrucksweise habe ich dabei allerdings nicht gelernt. Mir war (und ist immer noch) eine beziehungsförderliche, wertschätzende Sprache wichtiger als eine ehrliche Wiedergabe der negativen emotionalen Wahrheit zwischen den Konfliktparteien und auch meiner eigene aktuellen Gefühlslage. Die Konfliktparteien äußerten gelegentlich mit kritischem Unterton ihr Erstaunen für meine „Geduld“, die sie selbst nicht aufbringen könnten, oder ihre zwiespältige Bewunderung für meine „freundlichen“ Formulierungen beim aktiven Zuhören. Ich konnte ihre aktuellen Gefühle zwar „höflich umformulieren“, habe aber die Wucht der negativen Gefühle zwischen ihnen nicht deutlich gemacht. Dabei bin ich offenbar beiden Seiten nicht gerecht geworden. Die wütende Seite fühlte sich „weichgespült“ („Ich bin nicht ‚verärgert‘, wie Sie sagen, sondern ich koche geradezu vor Wut!“) und die andere unverstanden („Ich erlebe die andere Seite nicht nur ‚dominant‘. Sie vergeudet unsere Zeit mit endlosem Geschwafel.“). Auch meine eigene Verärgerung oder Frustration über manche Einstellungen und Verhaltensweisen der Konfliktparteien habe ich nicht gezeigt, z.B. bei ihren häufigen Versuchen, die Verantwortung für die Konfliktlösung der anderen Seite, Dritten oder mir zuzuschieben.
Ich habe viele Mediator:innen noch höflicher als mich erlebt und denke inzwischen, dass dieses sozialverträgliche Bild der Mediation von vielen Konfliktparteien anziehend erlebt, zugleich aber auch kritisch gesehen wird. Es ist kein Wunder, dass Mediation für weite Teile der Bevölkerung wirklichkeitsfremd wirkt und ihrer Konfliktwelt von Richtern und Rivalen, Sieg und Niederlage sowie Erniedrigung und Hass oft gar nicht entspricht bzw. zu weich begegnet. Anders ausgedrückt: Ich finde, dass die Mediation ein Ehrlichkeitsproblem hat. Die mediierende Person unterbindet die erregte Auseinandersetzung durch die sozialverträgliche Steuerung der Kommunikation in einem emotionalisierten Streit-Kontext und damit den ehrlichen Ausdruck der emotionalen Wahrheit der Situation. Mediation basiert auf der Annahme der Gleich-Gültigkeit der verschiedenen subjektiven Sichtweisen der Beteiligten. Die Anerkennung unterschiedlicher „Wahrheiten“ ist für das Verstehen beider Seiten unabdingbar. Aber sie kollidiert mit dem – zwiespältigen – Bedürfnis der Konfliktparteien nach Wahrhaftigkeit in der Mediation. Ich habe oft gespürt, dass dieses sozialverträgliche Bild von Mediation vielen Konfliktparteien auf der Oberfläche zwar die Befürchtung nimmt, dass es zu erregter Auseinandersetzung kommt. Darunter wird es aber zugleich als unehrliche Höflichkeit erlebt, die für eine realistische Konfliktlösung kaum eine tragfähige Grundlage bietet. Ich sehe dies als Dilemma, das ich lange Zeit zu Lasten der Wahrhaftigkeit umgangen habe.
Vor 20 Jahren lernte ich in der Zusammenarbeit mit meinem US-amerikanischen Kollegen Jay Rohman, die Konfliktparteien aufzufordern, zunächst in unserer Gegenwart ca. eine halbe Stunde lang selbst zu versuchen, ihre Konfliktpunkte zu lösen. Wir würden vorher nur eingreifen, wenn sie uns dazu auffordern. Durch die Beobachtung eines längeren Interaktionsprozesses haben wir ihre (unterschiedlichen) Gefühlszustände und deren Dynamik differenzierter erkennen und anschließend deutlicher benennen können als bei der „kurzen Leine des aktiven Zuhörens“, das in diesem Schritt des mediativen Vorgehens angesagt war und immer noch angesagt ist.
Zur Verringerung meiner Tendenz, den Ausdruck eigener negativer Gefühle zu vermeiden, hat mich das Verhalten des ehemaligen finnischen Ministerpräsidenten und Friedensnobelpreisträgers Martti Ahtisaari in seinen politischen Mediationen angeregt. Seine Konfliktparteien und Co-Mediator:innen berichten, dass er seine Gefühle des Ärgers und der Ungeduld über die Verhaltensweisen der Konfliktparteien in unangenehmer Weise direkt zum Ausdruck bringen konnte (Ford, P.D. (2006). Got conflict? Mr. Ahtisaari is your man. Christian Sci. Monitor (May 4), http://www.csmonitor.com/2006/0504/p01s04-wogi.html [21.3.2021]). Das stand offensichtlich dem Erfolg seiner politischen Mediationen nicht im Weg. Sein Vorbild hat mir Mut gemacht, meine eigene Frustration oder Verärgerung situationsangemessen zum Ausdruck zu bringen – allerdings erheblich abgeschwächt. Hinsichtlich der Frage, wie sich spontaner Ausdruck negativer Gefühle von Mediator:innen auf die Beziehungsgestaltung und Konfliktlösung sowie die Ehrlichkeit und das darauf aufbauende gegenseitige Vertrauen auswirkt, ist die (dünne) Forschungslage widersprüchlich (Zhang, T., Gino, F., Norton, M.I. (2017). The Surprising Effectiveness of Hostile Mediators. Management Science (63, 6):1972-1992. https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2431 [25.9.2025]).
Die Empfehlung der themenzentrierten interaktionellen Methode nach Ruth Cohn (Cohn, R. (1975). Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion. Stuttgart: Klett-Cotta.), selektiv authentisch zu kommunizieren, scheint mir zurzeit immer noch ein fruchtbarer Ansatz zur Weiterentwicklung der Mediation. Es ist mir klar, dass damit das Dilemma nicht hinreichend abgeschwächt wird. Die Mediationsforschung müsste es sich ausgiebig vornehmen; z.B. hinsichtlich der Passung zu den (Sub)Kulturen der Konfliktparteien. Denn es kommt auch darauf an, mit welchen Parteien man zu tun hat. Ein sehr achtsamer Mediationsstil wirkt sich bei der Konfliktbehandlung in einem Kirchenvorstand wahrscheinlich deutlich anders aus als im Vorstand eines Rugby-Vereins. Die gegensätzlichen Kommunikationsstile von großen Bevölkerungsgruppen, die zurzeit den demokratischen Gesellschaften zu schaffen machen, scheinen mir ähnliche Probleme zu haben und bedürfen m.E. einer gesonderten Betrachtung.
Also: Ein immer nur freundlicher, emotional kontrollierter Kommunikationsstil von Mediator:innen wirkt wenig authentisch und dürfte die Bereitschaft zur Mediation begrenzen. Die Bearbeitung des genannten Dilemmas scheint mir eine Anforderung an die Weiterentwicklung der Mediation zu sein. Sie könnte dazu beitragen, dass die Mediation der Realität in der Vielfalt menschlicher Konflikte mehr und mehr entspricht und damit ihre häufigere Nutzung voranbringt.
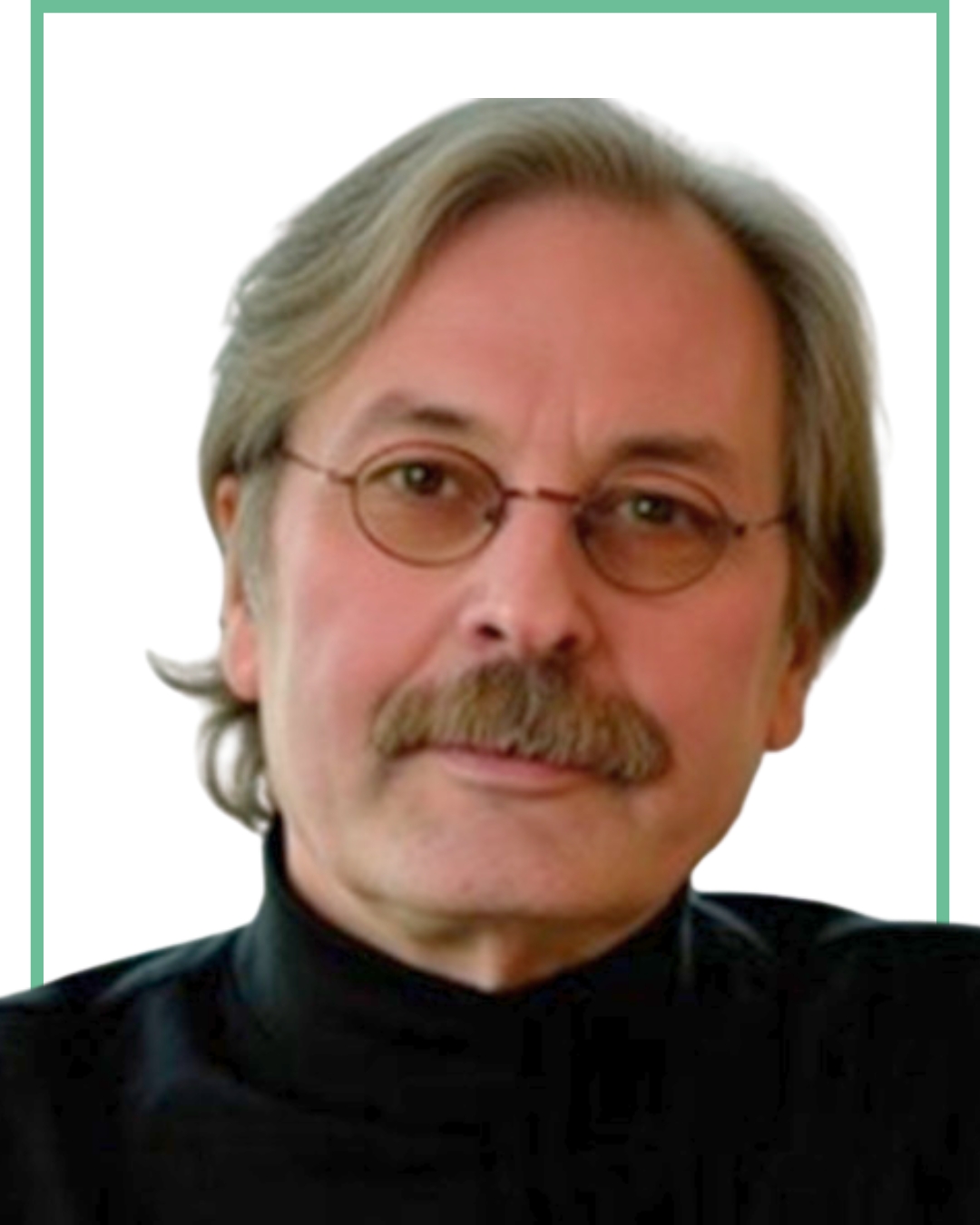
Mediation hat ihre beste Zeit nicht hinter sich – sie hat ihre eigentliche Zeit vielleicht noch gar nicht erreicht. Die vergangenen Jahrzehnte der europäischen Friedensdividende haben gezeigt, dass bloße staatliche Förderung nicht genügt, um Mediation selbstverständlich zu machen. Mediation ist kein Produkt, das sich wie eine technische Lösung „einführen“ lässt. Sie ist ein kultureller Ansatz des Umgangs mit Konflikten, der eine Haltung der Verständigung voraussetzt.
Gerade wenn politische Rhetorik wieder macht- und konfrontationsorientiert wird, wächst der Bedarf an Verfahren, die den Raum für Verständigung offenhalten. Mediation ist damit kein zartes Friedensutopie-Relikt, sondern ein Schatz, der in Zeiten erhöhter Polarisierung erst recht gefunden werden muss. Ihr Wert liegt nicht in der Etikette „Alternative zum Gericht“, sondern darin, den eigentlichen Bedarf – tragfähige Verständigung – zu adressieren, ohne die Lösung vorzugeben.
Die Vision einer mediativ geprägten Konfliktkultur bleibt daher unverändert aktuell. Was es braucht, sind nicht allein Förderprogramme, sondern Menschen, die diese Haltung leben, sichtbar machen und den Nutzen – nicht das Verfahren – kommunizieren. Wo gesellschaftliche Spannungen wachsen, kann Mediation ihre besondere Kraft entfalten: nicht trotz, sondern gerade wegen der lauter werdenden Stimmen der Konfrontation. Die Chance der Mediation liegt darin, dass sie den Weg in die Vernunft zeigen kann, wozu die Vernunft selbst nicht in der Lage ist. Siehe https://wiki-to-yes.org/article1310-Die-Stille-der-Vernunft
Dr. Daniela Rindone
Köln
Rechtsanwältin | Counsel
Wirtschaftsmediatorin
Zertifizierte Mediatorin
Website: cms.law

Dass die Mediation im europäischen Raum immer noch ein „Nischenprodukt“ ist, hat mehrere Ursachen. Mangelnde Sichtbarkeit, Machtasymmetrien und das damit einhergehende Bedürfnis nach rechtsstaatlicher Sicherheit und effektiven Schutzmechanismen sowie unsere Rechtskultur der Konfrontation sind nur einige Faktoren, die hierfür ursächlich sind. Herausfordernde geopolitische wie wirtschaftliche Zeiten erleichtern zwar nicht die breite Akzeptanz eines Konfliktlösungsansatzes, der auf (Selbst)Verantwortung, Fairness und Bildung von Brücken setzt. Die Mediation deswegen „abzuschreiben“, wäre jedoch falsch. Denn sie kann gerade in machtaufgeladenen Konstellationen einen konstruktiven Gegenentwurf zu Eskalation und Provokation darstellen und dazu beitragen, den sozialen gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Notwendigkeit von Kooperation wieder mehr in den Fokus zu rücken. Denn jede Lösung ist am Ende nichts wert, wenn Menschlichkeit und das Bestreben nach nachhaltigem Agieren auf dem Weg dorthin verloren gegangen sind.
Greg Bond
Berlin
Mediator,
Dozent in Mediation und Kommunikation
an der Technischen Hochschule Wildau,
Trainer
Website: www.bond-bond.de

Es ist richtig, dass der Optimismus der Jahre nach Ende des Kalten Kriegs vorbei ist. Eine große Ernüchterung stellt sich ein. Es kommen wahrscheinlich noch schwierigere Zeiten auf uns zu, sollten die politischen Verhältnisse in Europa sich weiterhin so verschieben, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das Gegeneinander hat zugenommen, in der Weltpolitik wie in Gemeinden und Gemeinschaften. Gemeinsame Lösungen werden nicht gesucht. Macht setzt sich durch. Dringende Probleme können nur schwer oder gar nicht so angegangen werden – der Klimawandel wartet nicht darauf, dass die Menschheit ihn begreift.
Ich teile nicht die hohen Erwartungen an die Mediation, die in der Fragestellung des „Roundups“ mitschwingen. Für mich steht auch nicht fest, dass die Bemühungen der letzten Jahre, Mediation zu etablieren, vergeblich waren.
1. Die Mediation ist nicht die heilbringende Lösung für Konflikte, für die sie manche zu halten scheinen. Sie ist eine Möglichkeit unter vielen, Probleme miteinander anzupacken. Legen wir das Missionarische und Messianische ab. Bieten wir pragmatische Verfahren an.
2. MediatorInnen haben nicht mehr und nicht weniger gesellschaftliche und politische Verantwortung als andere Berufe. Wenn Sie sich Sorgen um die politische Weltlage machen, dann werden Sie politisch aktiv. Erwarten Sie nicht von der Mediation, dass sie gesellschaftlich etwas bewirkt, was woanders verortet ist.
3. MediatorInnen wissen, dass sie in einem Anbietermarkt agieren. Sich darüber zu beschweren, dass die Mediation nicht ankommt, ist meines Erachtens falsch. Wir müssen daran arbeiten, dass sie bekannt(er) wird, und wir müssen das Produkt attraktiv machen. Möglicherweise hat die Mediation ein Qualitätsproblem. Politische Rahmenbedingungen helfen. Mediationsmarketing ist wichtig. Letztendlich entscheiden die NutzerInnen (VerbraucherInnen), ob es eine gute Sache ist. Wenn sie das tun, dann wächst der Markt.
4. Friedensmediation ist ein wichtiges Feld. Die meisten MediatorInnen arbeiten nicht in der Friedensmediation. MediatorInnen stiften keinen Frieden (außer in ihren eigenen Konflikten). Frieden wird von den Streitparteien geschaffen. Wir bieten Begleitung und Verfahren an, in den allermeisten Fällen in Streiten des Alltags – in Unternehmen und Organisationen, in Familien, als GüterichterInnen. Sorgen wir dafür, dass diese Verfahren gut sind.
Dr. Isabell Lütkehaus
Berlin
Mediatorin (QVM, BM, BAFM)
Supervisorin & Executive Coach (DGSv)
Rechtsanwältin & Buchautorin
Website: www.luetkehaus.berlin

Mediation als Weg der eigenverantwortlichen und einvernehmlichen Konfliktlösung sehe ich unabhängig von weltpolitischen Strömungen und internationalen Strategien.
Ebenso wie generell das wertschätzende und respektvolle Miteinander zwischen Menschen, Gruppen und Organisationen stets seinen eigenen Raum und seine besondere Berechtigung haben wird. Zugleich habe ich den Eindruck, dass – vielleicht gerade in Abgrenzung zu politischen Tendenzen – im Individuellen eine besonders stark ausgeprägte Achtsamkeit zu beobachten ist. Die ggf. zeitversetzt im Sinne einer Pendelbewegung auch im Politischen wieder stärker sichtbar werden wird. Vielleicht ist und wird Mediation nicht die “übliche Alternative” für alle Arten von Konflikte, aber ich bin mir sicher, dass sie im organisatorischen bzw. wirtschaftlichen Kontext ebenso wie im Privaten und nicht nur in bestimmten Bildungskreisen ihre Relevanz als nachhaltigen Lösungsweg behalten und weiter ausbauen wird, weil die Vorteile individueller Wege offenkundig sind.
Dr. Katharina Kriegel-Schmidt
Hamburg
Professorin für Soziale Arbeit & Sozialpädagogik,
Leitungsteam der bundesweiten Forschungsgruppe Mediation
Website: https://forschungsgruppe-mediation.weebly.com/
https://www.kriegel-schmidt.com/

Zwei kurze Antworten auf die zwei, thesenreich eingerahmten, Fragen:
1. Ja, Mediation erfährt mehr Zuspruch, trotz Populismus und Krieg.
2. Ja, Mediation hat vielleicht ihre beste Zeit hinter sich.
Was aber ist Zuspruch? Woran will man den Erfolg von Mediation (oder Beratung, Therapie, Coaching, … – allesamt das Individuum und seine Beziehungen stärkende, Selbstreflexion und -Artikulation fördernde Handlungskonzepte) gesamtgesellschaftlich messen?
Zu 1.) Meine Student:innen sind mit populären Kommunikationstechniken wie dem Aktivem Zuhören, Ich-Botschaften, GFK usw. schon vor ihrem Studium vertraut, Schulen bilden Konfliktlotsen aus, Unternehmen verweisen auf Mediationsangebote. Keiner stolpert mehr ernsthaft über das Wort Mediation. Jüngere Menschen kennen das: Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Das ist mindestens ein Ideal, was es früher nicht war. Dazu gibt es auch schon ein Know-How. Die Kultursoziologie zeigt, dass Menschen von heute genau das verinnerlicht zu haben scheinen, was Mediation im Konflikt hervorbringen helfen will: nicht die Orientierung am Normalen, der Norm, dem Anderen, sondern am Besonderen, der Einzigartigkeit, dem Eigenwert, der Unterscheidbarkeit, der kreativen, selbst-verantworteten Lebensgestaltung. Mediation fügt sich, mit Reckwitz gesprochen, in die soziale Logik der Singularisierung ein.
Zu 2.) Ausbildungen oder Angebote finden nicht genügend Absatz. Es gibt (noch immer) keinen Fachdiskurs, wenig Bezugnahmen aufeinander, kaum empirische Mediationsforschung. Es gibt eine Mediationsberufslandschaft, deren Mitglieder – würde man sie den SINUS Milieus zuordnen – vielleicht gerade mal in drei Milieus zu verorten sind. Mediation lässt sich (auch) instrumentalisieren. Sie kann Energie binden, folgt man Bröckling, wo Protest und Aufbegehren wirkungsvoller (und wichtiger) wären. Es herrscht Mangel und es gibt Probleme. – Vielleicht kommt da professionell auch nicht mehr sehr viel.
Daher würde ich nun schlussfolgern: Erfolgsfantasien sollten wir in den 00er und 10er Jahren zurücklassen. Sinnvoller erscheint mir, zu sehen, dass die mit Mediation assoziierten Handlungen, Überlegungen und Wünsche Teil einer wirkmächtigen kulturellen Entwicklung waren und vielleicht noch eine Weile sein werden.
Kirsten Schroeter
Hamburg
Mediatorin & Ausbilderin BM®,
Wissenschaftliche Leitung im Master-Studiengang
Mediation und Konfliktmanagement an der
Europa-Universität Viadrina
Mitherausgeberin KonfliktdDynamik
Website: www.mediation-altona.de

Im Angesicht von Krieg, der damit unweigerlich verbundenen Zerstörung von Leben und Lebenswelten und dem damit verbundenen Leid, ist die Frage nach dessen Wirkungen für das Feld der Konfliktbearbeitung wahrlich nicht die erste, die sich mir stellt.
Lasse ich mich dennoch darauf ein, dann ziehe ich es vor, eine eher optimistische Perspektive einzunehmen – auf verschiedenen Ebenen.
Was das konkrete Aufkommen an Mediationsfällen auf einer ganz persönlichen Ebene angeht, fällt mir das eher leicht. Es mangelt nicht an Fallanfragen. Mich erreichen seit vielen Jahren deutlich mehr Anfragen, als ich bedienen könnte – nicht nur deswegen bin ich froh, auf ein großes Netzwerk an kompetenten und erfahrenen Kolleg:innen zugreifen zu können, die dann übernehmen. Auch jenseits des Fallaufkommens im eigenen Nahbereich erlebe ich in den Feldern, in denen ich einen vertieften Einblick habe – in der Konfliktbearbeitung in Unternehmen, in kulturellen oder politischen Organisationen, in ehrenamtlichen Bereichen, in Bildung und Forschung, in Kontexten gemeinschaftlichen Wohnens, im Bereich der güterichterlichen Mediation – stabile bis steigende Fallzahlen. Insofern zweifle ich an der viel verwendeten Erzählung des „knappen Kuchens“ und der mangelnden Fälle. Statt einen (vermeintlichen) Mangel zu beklagen, erscheint es mir produktiver, dass wir uns als Mediator:innen selbstkritisch fragen, was wir noch nicht ausreichend anbieten oder was uns noch nicht ausreichend gelingt – damit Menschen in konkreten Konflikten Mediation als nutzbringend und entlastend erleben.Was die in der Frage angezielte internationale Dimension angeht, fällt mir die optimistische Perspektive schwerer – angesichts des Krieges in Europa, aber auch, weil ich keine Expertin für diese Domäne bin. Hier höre ich sehr aufmerksam den Kolleg:innen mit spezifischer Expertise in diesem Feld zu. Ich gehe davon aus, dass vermutlich auch hier viel mehr Aktivitäten stattfinden als wir ahnen. Hinter den Kulissen, wo eben in der Regel der richtige Platz für die mühevolle Arbeit des Wiederaufbaus von zerstörtem Vertrauen und abgebrochenen Kommunikationskanälen ist. Mit langem Atem, Beharrlichkeit, einer gewissen Unerschrockenheit – insbesondere im Umgang mit aggressiven Vorgehensweisen, mit Rückschlägen und Scheitern –, mit klaren Worten und Zuversicht.
In zehn oder zwanzig Jahren, in der Rückschau, wird sich die gestellte Frage wohl leichter beantworten lassen. Einstweilen ziehe ich es vor, optimistisch zu bleiben. Und weiterhin davon auszugehen, dass es maßgeblich an Mediator:innen liegt, ihres dazu zu tun, dass ihr Beitrag als ausreichend sinnvoll erlebt werden kann – und sich insofern immer wieder neu den erhofften Zuspruch selbst verdienen.
Dr. Martin Probst
Schleswig
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht
Mediation beim Güterichter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, Koordination
Website: http://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/OLG

Eine wichtige- und gewichtige Umfrage.Was haben wir vielleicht erhofft? Und was durften wir realistischerweise erhoffen?Mediation ist in Deutschland bekannter geworden (Ich zögere zu sagen wirklich „bekannt“) und ist unser Profis zumindest eine Option geworden. Das ist auch bei meinen Güterichterinnen und Güterichtern so. Von daher haben wir einen gewissen „Sockel“ an Mediationen, der sich allerdings nur mühselig erweitern lässt , zumal der „Hype“ des Neuen auch schon wieder vorbei ist. Ich denke aber, dass gutes und nachhaltiges Arbeiten am ehesten Erfolge hat und sich eben auch herumspricht.
Thomas Robrecht
Unterföhring
Organisationsberater, Trainer,
Coach und Mediator
Website: https://www.sokrateam.de

Es gibt einige Selbstbegrenzungen der Mediation, mit der sie sich immer mehr ins Abseits manövriert:
Erste Selbstbegrenzung: Mediation als Alternative zum Rechtstreit
Dieses Verständnis reduziert Einsatzmöglichkeiten enorm. Es gibt viel mehr Anwendungen der Mediation, bei denen juristische Fragen nachrangig bis irrelevant sind.
Zweite Selbstbegrenzung: Menschen von Mediation überzeugen wollen
Wer Mediation gelernt hat, ist meist beseelt von dem tiefen Wunsch, die Welt an den eigenen positiven Erfahrungen teilhaben zu lassen. Das kann auf Menschen, die nichts von Mediation wissen, als missionierend erlebt und deshalb abgelehnt werden.
Dritte Selbstbegrenzung: Suche nach Interessen und Bedürfnissen
Die Ergründung von Interessen und Bedürfnissen kann für Menschen mit einer ausgeprägten Selbstreflexion sehr hilfreich sein. Wenn diese Fähigkeit gering ausgeprägt ist, erweist sich dieser Weg als höchst steinig und beschwerlich. Der in unserer Gesellschaft immer stärker wirkenden Sog einfacher Antworten lässt Rückschluss auf eine eher abnehmende und geringe Reflexionsfähigkeit zu.
Vierte Selbstbegrenzung: Der Selbstbezug der Qualitätsdefinition
Die Qualität von Mediationsausbildung sollte einer Definition von Mediationsqualität dienen. Doch es gibt kein belastbares Verständnis von Mediationsqualität.
Lösungsansatz für die Aufhebung der Selbstbegrenzungen: Damit Mediation in unserer Gesellschaft einen festen Platz erhält, muss sie sich als eigenständige Profession des Konfliktmanagements verstehen und etablieren.
Tilman Metzger
Lüneburg
Mediator und Mediationstrainer
Jurist
Website: www.tilmanmetzger.de
www.mediationsausbildung.de

Es ist nicht bedauerlich, dass Mediation in Deutschland keine „übliche Alternative zum Gericht“ geworden ist. Ich finde die Perspektive der OLG-Präsidentin und Mediatorin Stefanie Otte bemerkenswert, welche sie im Podcast mit Sascha Weigel beschreibt: In einem Rechtsstaat braucht es eine ausreichende Anzahl gerichtlich ausgetragener Streitigkeiten, damit es einen kontinuierlich fortgeschriebenen öffentlichen Maßstab dafür gibt, was als Recht zu betrachten ist. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass ein funktionierender Rechtsstaat auch in westlichen Demokratien nicht mehr als Selbstverständlichkeit zu betrachten ist, sondern als ein hohes Gut, das es aktiv zu nutzen und zu verteidigen gilt.
Die Stärke der Mediation ist nicht, dass sie klagewillige Menschen vom Rechtsweg abhält. Die Stärke der Mediation ist, dass sie Konflikte klären hilft, lange bevor diese durch die rechtliche Brille betrachtet werden. Mediation ist heute ein normales Instrument der Beziehungspflege: Immer mehr Managementteams führen jährlich einen Mediationsworkshop durch. Betriebe und Privatleute ziehen immer früher im Konfliktverlauf Mediation in Betracht. Die Ansprüche an Kommunikation sind in den zurückliegenden Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Dadurch wurde es immer üblicher, sich frühzeitig von Konfliktprofis weiterhelfen zu lassen.
Solange wir in einer liberalen Demokratie leben, werden Justiz und Mediation florieren – und umgekehrt.
Dr. Sonja Fücker
Bielefeld
Soziologin und Mediatorin
Website: https://ekvv.uni-bielefeld.de/pers_publ/

Die Welt dreht sich anders, wenn Angst und Sorge im Raum stehen. Mit der Aussicht auf eine greifbare Wirklichkeit von Krieg, die nicht mehr nur in anderen weit entfernten Teilen dieser Welt erfahrbar wird, sondern vor der eigenen Haustüre in Westeuropa, haben wir uns gesellschaftlich wie schon lange nicht mehr mit dem Wert von Frieden, Sicherheit und Verteidigung auseinanderzusetzen. Die allgemeine hohe Zustimmung zur Wiedereinführung der Wehrpflicht in der Bevölkerung (z.B. Ipsos, Statista) zeigt: Frieden ist keine Selbstverständlichkeit mehr wie in den vergangenen Jahrzehnten. Das war real natürlich auch vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine nicht der Fall, wenn man den Blick auf andere Teile dieser Erde und die Fragilität weltpolitischer Unwägbarkeiten richtete. Möglich war jedoch, die Vorstellung von Krieg auszublenden, weil sie nicht auf dem Radar der unmittelbaren Lebenswirklichkeit unserer und anderer westeuropäischer Gesellschaften stand.
In diesem Spannungsfeld hat es ein Verfahren wie die Mediation, das auf wechselseitige Verständigung anstatt machtorientierter Interessendurchsetzung setzt, schwer, zukünftig (mehr) Gehör zu finden. Dass sie sich als „echte“ Alternative zur gerichtlichen Streitbeilegung oder in bewaffneten Konflikten bislang nicht durchsetzen konnte, wird angesichts aktueller Entwicklungen besonders sichtbar. Es stellt sich die Frage, ob Mediation in diesem Klima überhaupt zeitgemäß sein kann – oder ob ihre Praxis zum anachronistischen Wunsch verkommt.
Zwei Gedanken dazu: Zumutung und Zuversicht der Mediation
Mediation fordert Konfliktparteien heraus, gegen häufig instinktive Impulse anzusteuern – und stattdessen auf Verständigung zu setzen. Damit ist sie per se eine Zumutung für den Umgang mit Ängsten, Kontrollverlust und dem Bedürfnis nach Sicherheit. Dass im Vergleich zu der hohen Zustimmung einer Wiedereinführung der Wehrpflicht nur eine kleine Zahl in der Bevölkerung (16% lt. Forsa-Umfrage) sich vorstellen kann, im Kriegsfall zu kämpfen, stellt auch eine Zuversicht für die Mediation und ihre Entwicklung in Aussicht. Die Vorstellung von Krieg ist zwar erschreckend real geworden – und gleichzeitig sind kriegerische Auseinandersetzungen für Menschen eher unvorstellbar in ihrer Durchführung. Das geht einher mit einem hohen Bewusstsein für den Wert von Verständigung in der Gesellschaft. Studienergebnisse („Konfliktmonitor“ der ConflictA – Universität Bielefeld) zeigen hohe Zustimmungswerte, dass gesellschaftliche und politische Konflikte vorrangig durch Dialog und Kompromissfindung zu regeln seien.
In dieser gesellschaftlichen Gemengelage sind Hoffnungen und Befürchtungen enge Wegbegleiter der Mediation:
Zum einen der zuversichtliche Glaube an gewaltfreie Verständigung durch Dialog und Kompromiss, zum anderen die Angst vor dem Verlust von Sicherheit und Kontrolle, die Mediation gerade in diesen Zeiten zur Zumutung macht.
Um die Hoffnungsfunken für Mediation zu stärken, sollten die häufig langwierigen, mühsamen und „leisen“ – auf der politischen Hinterbühne erzielten – Erfolge von mediativer Praxis in ihren Resultaten sichtbar(er) gemacht werden. Etwa das über Jahrzehnte andauernde Abkommen zum Waffenstillstand zwischen Nord- und Südkorea, das in wohl über 500 (!) Sitzungen verhandelt wurde. Oder der von Jimmy Carter initiierte Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel auf Camp-David in den 1970er Jahren.
Sascha Weigel
Leipzig
Mediator, Konfliktberater, Podcaster
Initiator der Roundup-Posts
Website: www.elemente-der-mediation.de

Dass die Moderne Mediation mit hochfahrenden bis weithin überzogenen Hoffnungen von Beginn an konfrontiert wurde hatte seine Gründe. So sehr die Fördergruppen der Mediation (Stakeholder) unterschiedliche Probleme zu bewältigen hatten und deshalb auch unterschiedlich motiviert waren, so war ihnen dennoch gemeinsam, dass ihnen die Mediation verheißend erschien. Grund dafür war die Annahme, dass die Adressaten eines Mediationsangebots, die Konfliktparteien ebenfalls als Fans der Mediation fantasiert wurden. Doch für diese Annahme gab es keinerlei Anhaltspunkte oder Datengrundlage. Mit einigem Abstand lässt sich nun sagen: Das war ein Irrtum. Und deshalb wäre es auch ein Irrtum, wenn infolge einer gewissen Katerstimmung die Schlussfolgerung gezogen würde, die Hochzeit der Mediation sei vorbei.
Ob Mediation sich aber nicht nur in gewissen Kreisen etabliert, sondern auch weit ausgreifend in der Gesellschaft Anwendung findet, hängt, so die Erfahrungen bisher, wenig von den Konfliktparteien ab, sondern von denjenigen, die auch Einfluss darauf haben, ob diese Konfliktparteien die Schwelle zur Mediation überschreiten. Sie sind m.E. die wichtigsten Befürworter von und für Mediation: die Umfeldpersonen eines Konflikts.
Als Umfeldpersonen eines Konflikts gelten die „auch“ Betroffenen und Berührten eines Konflikts, nicht die Beteiligten selbst; es sind die Teammitglieder bei einem Konflikt zwischen zwei der Ihren oder der Vorgesetzte bei einem Konflikt im Team ebenso wie Vereinskameraden oder Familienmitgliedern, die die Auswirkungen des Konflikts zu spüren bekommen, die Mitschüler und Lehrer bei Konflikten in der Schule, die Zulieferer etwa bei einem Arbeitsplatzskonflikt, Kinder und Geschwister(!) bei Trennungs- und Scheidungskonflikten, die Anwohner und Bürger bei Infrastrukturprojekten, aber auch die abstrakten, sprich juristischen Personen, also Organisationen sind Umfeldpersonen: Kommunen, Firmen, auch Behörden, sogar Gerichte, all jene, die ein hohes und verständliches Interesse daran haben und im Laufe eines eskalierenden Konflikts entwickeln, das die Konfliktparteien ihre Probleme produktiv bearbeiten, statt ausschließlich konfliktär auszutragen, zivilisiert, verbindlich und vielleicht auch verbindend.
Dieses Umfeld erlebt den Konflikt wie eine Sogveranstaltung für die eigene Aufmerksamkeitsfokussierung, spürt den sozialen Druck durch die Konfliktparteien (der einen Seite zuzustimmen und die andere abzulehnen!) – und ist selbst Ausgangspunkt für sozialen (Gegen-)Druck, der die Konfliktparteien adressiert. Hier anzusetzen besteht Nachholbedarf. Für die weitere Entwicklung der Mediation als Verfahren und Methode möchte ich deshalb empfehlen, dass Zielrichtung neu justiert werden muss. Angebote, Strukturhilfen und Ideen sollten sich zukünftig hierauf konzentrieren. Denn für produktives Konfliktmanagement sind nicht ausschließlich die Konfliktparteien verantwortlich.
Robert Erkan
Hanau
Zertifizierter und lizenzierter Mediator (BM),
systemischer Berater,
Kommunikationstrainer
Website: www.erkan-communication.de

Die Frage, ob die Mediation ihre beste Zeit hinter sich hat oder gerade jetzt an Bedeutung gewinnt, lässt sich nicht einfach beantworten. Klar ist: Eine Grundetablierung hat stattgefunden. Ob sie zum bedeutenden Player gesellschaftlicher Konfliktbearbeitung wird, ist offen.Gerade angesichts des Kriegs in der Ukraine, der Eskalationen im Nahostkonflikt, einer geopolitischen Lage, in der Demokratie, Menschenrechte und die freiheitliche Grundordnung in Frage gestellt werden, zeigt sich der wohl schwerster gesellschaftlicher Stand seit Jahrzehnten – und zugleich wächst ihre Relevanz. Denn wo Polarisierung, Angst und Machtlogiken dominieren, braucht es Räume, in denen Verständigung möglich bleibt – ohne die Gefahr, instrumentalisiert zu werden.Hier zeigen sich viele Spannungsverhältnisse: Brücken bauen oder Grenzen ziehen? Allparteilichkeit bewahren oder klare Abbrüche ermöglichen? Für mich ist das kein Widerspruch. Es bedeutet, Dialog zu ermöglichen, wo er tragfähig ist, und Verantwortung zu übernehmen, wo Instrumentalisierung droht.Dabei geht es nicht nur um moralisch-ethische Fragen, sondern auch um den Schutz von Mediator:innen. Wer gesellschaftlich unbequeme Konflikte begleitet, muss darauf vertrauen können, gewappnet zu sein, nicht von der Öffentlichkeit „zerrissen“ zu werden. Das Zutrauen in unsere Neutralität und Allparteilichkeit ist ein öffentliches Gut, das wir bewahren, schaffen und immer wieder erneuern müssen.Deshalb braucht es – neben der „personenzentrierten“ und der „organisationalen“ Mediation – eine dritte Säule: die gesellschaftlich-öffentliche-politische Mediation. Hier sind klare Leitplanken, fachlicher Austausch und mutige Selbstvergewisserung notwendig. Im Bundesverband Mediation entstehen dazu wichtige Schritte, mit der Gründung einer Fachgruppe, die ich als Vorstand begleite und unterstütze.Fazit:Ich sehe kaum ein berufliches Handwerk und Haltung wie wir Mediator:innen, in Verantwortung diese Herausforderungen annehmen zu können – wenn sogar müssen. Dafür ist eine solide Grundausbildung ebenso bedeutsam wie Praxiserfahrung in den ersten beiden Säulen, um die dritte verantwortungsvoll gestalten zu können.
Ute Liepold
Bruchsal
Mediatorin BM®,
Konfliktberaterin,
Klärungshelferin IfK®
Website: https://ute-liepold.de

Wird die Mediation durch die in der Fragestellung genannten Zuspitzungen (Kriege, harte Konfrontationsstrategien) Aufwind erhalten? Ich hoffe es, und ich möchte diese Hoffnung mit einem einfachen Gedankengang begründen: Erzeugen die aktuell zu beobachtenden Strategien Zuversicht, dass damit Konflikte lösbar sind – im Sinne von echter Befriedung? Nein. Im Gegenteil: wir sehen Polarisierung, Eskalation, sich verschärfende Gewalt.
Wir sehen auch, z. B. am Beispiel Israel/Palästina, dass unbewältigte Konflikte über Jahrzehnte und Generationen wieder und wieder aufbrechen und Leid erzeugen.
Mediation tritt an, um Lösungen zu finden, die befrieden.
Ich bin seit 16 Jahren als Mediatorin in Organisationen unterwegs. Dort werden Entscheidungen für und gegen Mediation von Führungskräften getroffen. Diese Entscheidungen sind nach meiner Erfahrung immer auch wertebasiert: Da ist eine Führungskraft, die Frieden will. Ich erlebe bei mir und anderen, dass diese Sehnsucht nach Frieden durch das aktuelle Weltgeschehen stärker wird. Und daraus leite ich ab: Der Boden ist fruchtbar, gerade jetzt, um über Mediation zu sprechen, Führungskräfte entsprechend zu beraten und zu unterstützen. Ich werde sehr gerne und mit Überzeugung weiterhin meinen Beitrag dazu leisten.




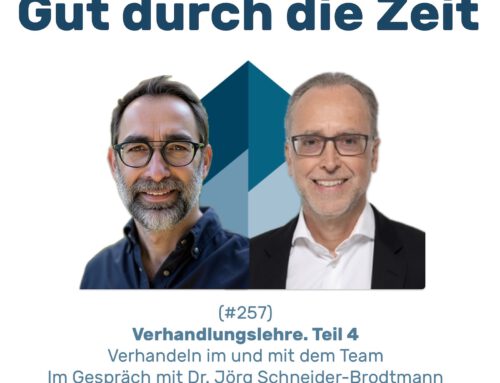
Hinterlasse einen Kommentar