INKOVEMA-Podcast „Gut durch die Zeit“
#194 – Mediation in Strafsachen – Täter-Opfer-Ausgleich und seine Besonderheiten in Sexualdelikten
Beiträge aus der Konfliktdynamik. Teil 2
Im Gespräch mit Hilke Kenkel-Schwartz
Hilke Kenkel-Schwartz: Pädagogin (B.A.) und Mediatorin (BM), Geschäftsführerin Konfliktschlichtung e.V. Oldenburg, Expertin für Mediation in Strafsachen, Systemische Familientherapeutin, Sozialmanagement (MA) i. A.
Gut durch die Zeit.
Der Podcast rund um Mediation, Konflikt-Coaching und Organisationsberatung.
Kapitel
0:13 – Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit
1:45 – Einführung in den Täter-Opfer-Ausgleich
3:15 – Historische Entwicklung der Mediation
7:15 – Unterschiede zur allgemeinen Mediation
14:51 – Auswirkungen auf die Opferperspektive
23:32 – Die Rolle der Mediatoren im Prozess
35:36 – Herausforderungen im Täter-Opfer-Ausgleich
39:57 – Die Bedeutung der Allparteilichkeit
45:50 – Spezielle Anforderungen bei Sexualdelikten
52:22 – Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen
59:28 – Fazit und Ausblick auf die Zukunft
Zusammenfassung
In dieser Episode laden wir Hilke Kenkel-Schwartz, die Geschäftsführerin des Vereins Konfliktschlichtung in Oldenburg, ein, um über den Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) zu sprechen. Wir beleuchten die Herausforderungen und Besonderheiten dieser Form der Mediation im Strafrecht, die sowohl rechtliche als auch soziale Dimensionen umfasst. Hilke bringt ihre umfangreiche Erfahrung mit und erklärt, wie der TOA in Deutschland funktioniert und welche historischen Entwicklungen zu seinem heutigen Verständnis geführt haben.
Der TOA wird als ein Instrument innerhalb der Restorative Justice betrachtet, das darauf abzielt, sowohl die Täter als auch die Opfer in den Mittelpunkt des Prozesses zu stellen. Hilke legt dar, dass es entscheidend ist, die spezifischen Bedürfnisse der Betroffenen zu erkennen und zu berücksichtigen, insbesondere wenn es um schwere Delikte wie Sexualstraftaten geht. Gemeinsam erörtern wir die Notwendigkeit einer sensiblen und differenzierten Herangehensweise, die sowohl die Opfer als auch die Täter in ihrem menschlichen Potenzial sieht, anstatt sie nur durch ihre Taten zu definieren.
Ein zentrales Thema der Diskussion ist die Allparteilichkeit der Mediatoren im TOA. Hilke beschreibt, wie das Verständnis und die Handhabung dieser Rolle besonders in Fällen sexualisierter Gewalt angepasst werden müssen. Es wird deutlich, dass eine exklusive Beziehung zwischen dem Mediator und dem Opfer dazu beitragen kann, Vertrauen aufzubauen und eine offene Kommunikation zu ermöglichen, ohne dass der betroffene Person das Gefühl vermittelt wird, ihre Sicherheit könnte gefährdet sein.
Wir besprechen auch die strukturellen Herausforderungen, die den TOA in der Justiz behindern, einschließlich der Unsicherheiten in der Fallüberweisung durch Staatsanwälte. Hilke hebt hervor, dass trotz der rechtlichen Rahmenbedingungen, die seit den 80er Jahren existieren, nach wie vor eine Diskrepanz zwischen dem Potenzial des TOA und dessen tatsächlicher Anwendung besteht. Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von internen bürokratischen Abläufen bis hin zu mangelndem Wissen über die Methode in der Justiz.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Rückmeldung der Beteiligten nach dem TOA und wie gesunde Begegnungen und Dialoge zwischen Tätern und Opfern tatsächlich zur Wiederherstellung von Vertrauen und zu einer verbesserten Lebensqualität für die Betroffenen führen können. Hilke teilt Erfahrungsberichte über Menschen, die es als heilsam empfunden haben, ihre Geschichten und ihre Verletzungen im Rahmen des TOA zu teilen und dadurch eine gewisse Form von Heilung zu erfahren.
Wir schließen die Episode mit einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der Mediation im Strafrecht und der Hoffnung, dass durch Bildung und Sensibilisierung in der Justiz neue Impulse für den TOA entstehen können. Hilke ermutigt alle, die sich mit Mediation fortbilden möchten, einen Blick in diesen Bereich zu werfen, denn die Prinzipien der Restorative Justice bieten wichtige Lektionen für alle Mediatoren. Es bleibt festzuhalten, dass der TOA ein wertvolles Werkzeug zur Förderung eines gerechten und rehabilitativen Umgangs mit Konflikten darstellt.
Informationen zum Täter-Opfer-Ausgleich, § 46 a StGB
Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) ist ein Verfahren der außergerichtlichen Konfliktlösung im Strafrecht, das darauf abzielt, den Täter und das Opfer eines Verbrechens in einem geschützten Rahmen zusammenzubringen, um über die Folgen der Straftat zu sprechen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Ziel des TOA ist es, den durch das Delikt entstandenen Konflikt auf eine Weise zu bewältigen, die sowohl die Bedürfnisse des Opfers als auch die Verantwortung des Täters berücksichtigt. Der TOA ist in Deutschland in § 46a Strafgesetzbuch (StGB) rechtlich verankert und kann (= muss nicht) zur Strafmilderung führen. Es handelt sich um eine Strafzumessungsregelung.
1. Geschichte und Entwicklung des TOA in Deutschland
Der Ursprung des Täter-Opfer-Ausgleichs lässt sich in den späten 1970er Jahren finden, als in Deutschland und auch international zunehmend ein Umdenken im Strafrecht stattfand. Inspiriert durch Restorative Justice-Ansätze, die ihren Ursprung vor allem in Nordamerika hatten, rückte die Wiedergutmachung für das Opfer und die soziale Reintegration des Täters verstärkt in den Fokus.
1986 startete das erste offizielle TOA-Modellprojekt in Braunschweig und Bremen. Der Erfolg dieses Projekts führte zur Anerkennung und Implementierung des TOA in das deutsche Rechtssystem.
Mit der Novellierung des StGB in den 1990er Jahren wurde der TOA durch § 46a gesetzlich verankert und ist seitdem eine anerkannte Form der strafrechtlichen Sanktionierung/Strafzumessung und Konfliktlösung. Es folgte eine breite Implementierung von TOA-Stellen in Deutschland, die seither kontinuierlich ausgebaut wurde. Der TOA wird von speziell ausgebildeten Mediator*innen durchgeführt, die neutral und unabhängig agieren.
2. Grundlegende Prinzipien und Rechtsgrundlagen
Der TOA basiert auf den Prinzipien der Wiedergutmachung und Verantwortung, im Gegensatz zur traditionellen Bestrafung. Der Ansatz beruht auf den Grundprinzipien des Restorative Justice–Modells, das die Heilung des Opfers, die Wiedergutmachung des Schadens und die Verantwortungsübernahme des Täters in den Vordergrund stellt. Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in den §§ 46a und 155a der Strafprozessordnung (StPO) sowie § 10 Jugendgerichtsgesetz (JGG), die eine Möglichkeit zur Strafmilderung bieten, wenn der Täter durch Wiedergutmachung oder durch ernsthafte Versuche dazu zeigt, dass er Verantwortung übernimmt.
Ein weiteres grundlegendes Element ist die Freiwilligkeit: Sowohl das Opfer als auch der Täter müssen bereit sein, am TOA teilzunehmen. Während des Prozesses haben beide Parteien die Möglichkeit, ihre Perspektive darzustellen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Diese Vereinbarung kann finanzielle Wiedergutmachung, Entschuldigungen oder andere symbolische Gesten umfassen.
Die Mediator*innen im TOA sind neutral und unterstützen die Kommunikation, indem sie den Raum für offene und sichere Gespräche schaffen. Ihre Aufgabe besteht darin, beide Parteien auf Augenhöhe zu behandeln und dabei zu helfen, eine konstruktive Vereinbarung zu finden. Das schließt keineswegs aus, dass für bestimmte Konstellationen eine besondere Schutzfunktion vor Retraumatisiserungen der Opfer etabliert wird.
3. Der Ablauf des Täter-Opfer-Ausgleichs (Skizzierung)
Der Prozess des Täter-Opfer-Ausgleichs besteht üblicherweise aus mehreren Phasen:
- Kontaktaufnahme und Vorbereitung: In der Regel wird die Initiative für einen TOA durch die Staatsanwaltschaft, das Gericht oder die TOA-Stelle selbst angeregt. Beide Parteien werden über das Verfahren informiert, und die Mediator*innen stellen sicher, dass beide freiwillig und vorbereitet teilnehmen.
- Erstgespräche: Beide Parteien führen vor dem eigentlichen TOA Einzeltreffen mit den Mediatoren, in denen Erwartungen und Wünsche besprochen werden. Hier wird der Rahmen geklärt, und der Mediator bereitet die Parteien auf das Zusammentreffen vor.
- TOA-Sitzung (Ausgleichsgespräch): Während des eigentlichen Treffens kommen Täter und Opfer in einem sicheren Raum zusammen. Das Opfer hat die Möglichkeit, seine Perspektive zu schildern, und der Täter wird ermutigt, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Die Mediatoren unterstützen das Gespräch und helfen bei der Formulierung von Vereinbarungen.
- Abschluss und Vereinbarung: Am Ende der Sitzung steht idealerweise eine konkrete Vereinbarung, die von beiden Seiten akzeptiert wird. Die Einhaltung der Vereinbarungen wird ggf. nachträglich kontrolliert.
- Evaluation und Abschlussbericht: Nach dem TOA erstellen die Mediatoren einen Bericht, der der Staatsanwaltschaft und dem Gericht übermittelt wird. Falls die Vereinbarung eingehalten wird, kann dies als strafmildernder Umstand gewertet werden.
4. Aktuelle Situation und Herausforderungen
Der Täter-Opfer-Ausgleich hat sich in Deutschland als Alternatives Konfliktbearbeitungsmodell durchaus bewährt und wird in den unterschiedlichsten Fällen angewendet, von kleineren Delikten bis hin zu schwereren Straftaten. TOA-Stellen sind mittlerweile in allen Bundesländern etabliert und bieten spezielle Programme für Jugendliche und Erwachsene an. Besonders im Jugendstrafrecht spielt der TOA eine wichtige Rolle, da er Jugendlichen die Möglichkeit gibt, aus ihrem Fehlverhalten zu lernen und Verantwortung zu übernehmen.
Eine aktuelle Herausforderung ist die Finanzierung der TOA-Stellen, da diese oft von staatlichen Zuwendungen und kommunalen Geldern abhängen. Der TOA ist zwar gesetzlich verankert, jedoch erhalten nicht alle TOA-Stellen die benötigten Mittel, um ausreichend Kapazitäten für ihre Arbeit bereitzustellen.
Ein weiteres Problem ist die Teilnahmebereitschaft, insbesondere von Seiten der Täter. Viele Täter lehnen den TOA ab, weil sie die Konfrontation mit ihrem Opfer und das Eingeständnis ihrer Schuld scheuen. Auch seitens der Opfer besteht gelegentlich Skepsis gegenüber dem TOA, insbesondere wenn das Verbrechen schwerwiegende emotionale oder physische Schäden hinterlassen hat. Eine bessere Aufklärung und Sensibilisierung könnten helfen, die Akzeptanz für den TOA zu erhöhen.
Im Ganzen jedoch muss auch konstatiert werden, dass sich die ursprünglichen Visionen und „Zielvorstellungen“ keineswegs bestätigt haben, so dass der TOA eher abebbt.
5. Bedeutung und Zukunftsperspektiven des Täter-Opfer-Ausgleichs
Der Täter-Opfer-Ausgleich stellt eine wichtige Alternative im deutschen Strafrecht dar und zeigt, dass eine konstruktive Konfliktbewältigung möglich ist. Studien haben gezeigt, dass TOA-Teilnehmer sowohl auf Opfer- als auch auf Täterseite häufiger mit dem Ausgang des Verfahrens zufrieden sind als im regulären Strafprozess, da das Verfahren Raum für persönliche Aussprache und Wiedergutmachung bietet.
In der Zukunft könnte der TOA weiter ausgebaut werden, insbesondere im Hinblick auf digitale Formate und eine stärkere Einbindung in die Justizsysteme. Auch eine stärkere gesellschaftliche Sensibilisierung und der Ausbau von Beratungs- und Unterstützungsangeboten für die Opfer könnten dazu beitragen, den TOA in Deutschland weiter zu etablieren und seine Wirksamkeit zu steigern. Aktuell besteht jedoch kaum Aussicht auf Realisierung, was keineswegs allein dem TOA zugeschrieben werden kann, sondern auch dem gesellschaftlichen Kontext zugesprochen werden muss.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen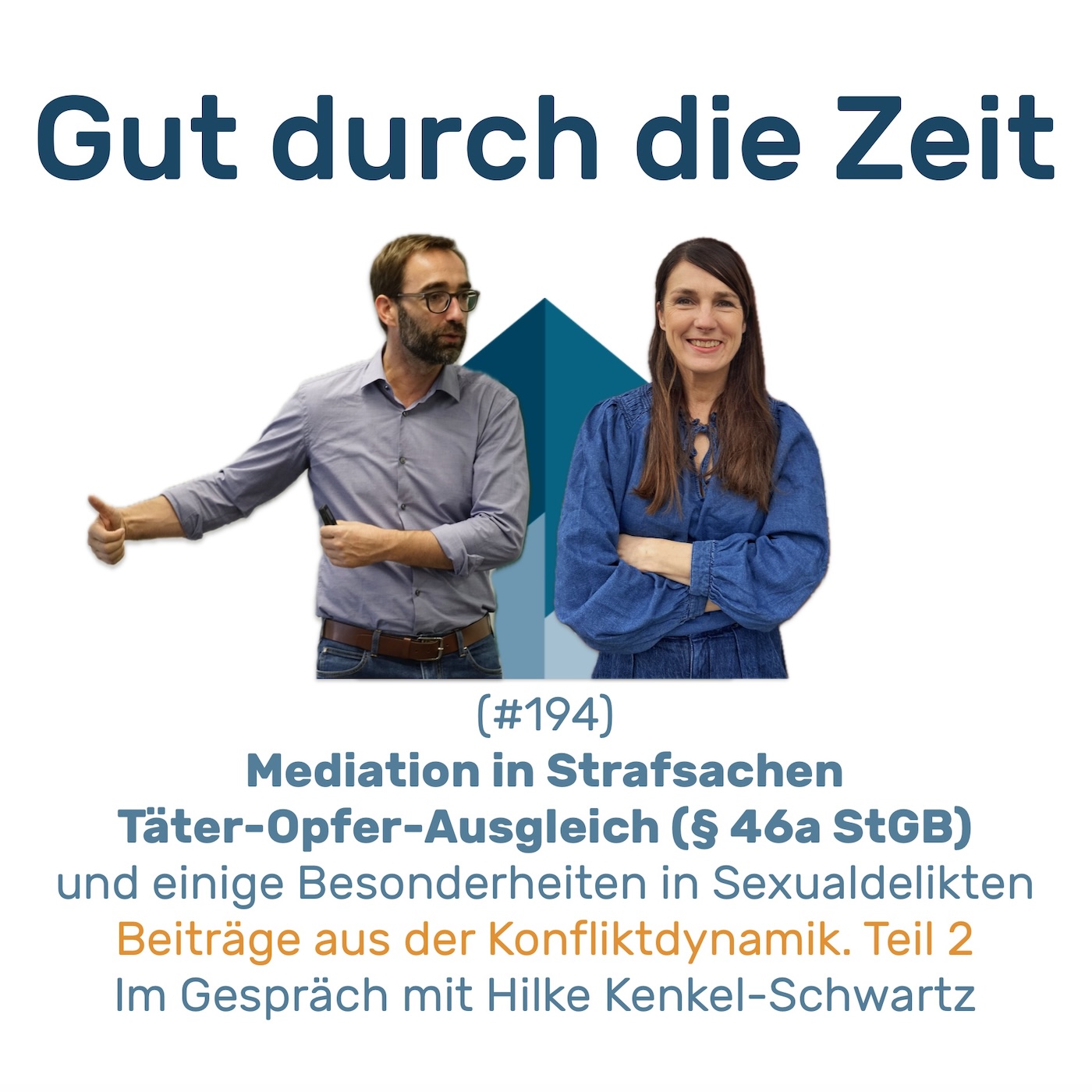



Hinterlasse einen Kommentar