Künstliche Intelligenz (KI) und neue Technologien in der Mediation
Chancen bei der Bearbeitung von Konflikten
Interview geführt von Friedhelm Röttger mit Prof. Dr. Sascha Weigel, Leipzig im Zuge des
Mediationstag am 21. September 2024
im Schleswig- Holsteinischen
Oberverwaltungsgericht
in Schleswig
Veröffentlicht in Schleswig-Holsteinische Anzeigen.
Justizministerialblatt für Schleswig-Holstein, März 2025.
Herr Professor Dr. Weigel, Sie sind Honorarprofessor an der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Konfliktberater und Mediator sowie Lizenzierter Ausbilder (BM und EATA). Am 21.9.2024 haben sie anlässlich des Mediationsfachtages am OLG Schleswig zum Thema “Künstliche Intelligenz und neue Technologien in der Mediation“ referiert.
Dazu habe ich einige Fragen:
1. Was ist Ihr Quellberuf und wie sind Sie über ihre Arbeit zu dem Thema „Mediation und KI“ gekommen?
Mein Quellberuf ist Jurist. Ich habe Rechtswissenschaften in Leipzig und Berlin von 1998 bis 2003 studiert und dann mein Referendariat bis 2005 in Sachsen durchgeführt. Zur Mediation bin ich gekommen über meine Ausbildung in Transaktionsanalyse. Das eröffnete mir die Beratungswelt jenseits der juristischen Fachberatung, sozusagen der Prozessberatung und -begleitung.
Das Thema neue Technologien und insbesondere KI schlug bei mir dann wesentlich später auf. Erst als selbstständiger Mediator, als der ich dann ab 2011 zu arbeiten begann, rückte das Internet samt seiner hardware-bedingten Voraussetzungen in meinen professionellen Fokus. Doch war dieser Entwicklungsschritt für mich ebenso bedeutsam wie der Schritt weg von der juristischen hin zur prozessbegleitenden Beratungspraxis.
2. Zu Beginn Ihres Vortrags lautete eine ihrer Kernthesen: „Die Frage ist nicht, ob und wann KI besser sein wird als der Mensch, sondern wer KI am besten nutzen kann und wie“. Können Sie diese These näher erläutern und meinen Sie wirklich, dass KI jetzt schon qualitativ besser ist als der Mensch?
Zum zweiten Teil Ihrer Frage: Nein, ich meine gerade nicht, dass KI jetzt schon besser ist als der Mensch. Das ist auch nicht relevant. Die These hebt eher darauf ab, dass in naher Zukunft Beratung und damit auch die Konfliktberatung im Wege einer Mediation besser durchgeführt wird mit künstlichen Intelligenzen als ohne sie. Und deshalb werden Mediatoren mit künstlichen Intelligenzen wohl eher beauftragt werden als Mediatoren ohne. Künstliche Intelligenzen sind Werkzeuge, keine Mitbewerber. Sie unterstützen Mediatoren bei ihren vorbereitenden, vermittelnden und nachbereitenden Arbeiten und machen sie auf ihre Weise zu besseren Mediatoren.
3. Sie haben verschiedene KI-Tools vorgestellt (z.B. Gemini, Perplexity, Llama, Meta, Claude, Copilot oder Chat-GPT). Für Juristen dürften die Research-, Writing- und Chatbot-Tools am interessantesten sein. Welche der Tools können Sie aus Ihrer Erfahrung für Richter und Rechtsanwälte – insbesondere im Rahmen der Mediation – besonders empfehlen?
Empfehlenswert für Research halte ich am ehesten noch Perplexity, weil es die Quellenangabe mit ausführt. Und Claude und Chat-GPT sind als Sprachmodelle und Hilfsmittel für Textgenerierung, aber auch für die Texterfassung und Zusammenfassungen, Dokumentation als Stichwort, meines Erachtens bisher am besten geeignet. Aber auch nicht zu vergessen Gemini. Das Google-Tool Notebook LM ist hervorragend, um sich Texte zu erschließen. Stichwort: Audiozusammenfassung.
Aber, hätte ich den Text auch nur einen Tag früher verfasst und abgesendet, hätte ich das Stichwort Deepseek nicht aufnehmen können. Die Entwicklung ist aufregend schnelllebig.
4. Sie haben in dem Forum eindrucksvoll demons-triert, dass Chat-GPT nicht nur ein Themen- und Ideengeber, sondern auch ein kompetenter Gesprächspartner zur Selbstreflexion sein kann. Wird Chat-GPT zukünftig z.B. bei der Hypothesenbildung im Rahmen der Mediation oder bei der Supervision helfen oder gar den Menschen ersetzen können?
Tools wie Chat-GPT, die eine Spracheingabe ermöglichen und mit denen wir uns regelrecht unterhalten können, werden sicher zur Eigenreflexion herangezogen werden, wie wir es uns heute kaum vorstellen können. Professionell werden damit nicht nur Therapie-, sondern auch Supervisions- und andere Klärungsgespräche möglich sein. Aber sie werden nicht die menschlichen Therapeuten, Coaches, Supervisoren und Berater ersetzen. Diese werden sich jedoch auf kompetentere Klienten einlassen müssen.
5. Die generative KI ist inzwischen mit beeindruckender Geschwindigkeit auch in der Rechtswirklichkeit angekommen. Um zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen, ist es entscheidend, an die KI die richtigen Fragen („Prompts“) zu stellen. Kann man „Legal Prompt Engineering“ schnell lernen oder bedarf es dazu einer speziellen Ausbildung?
Mit Sicherheit bedarf es einer spezifischen Übung, aber das lässt sich erlernen. Und außerdem gibt es mittlerweile KI-Anwendungen, die genau das übernehmen, die Qualität von Prompts prüfen und ausbessern. Erwähnt sei hier der Prompt-Generator von Anthropic auf dem Tool von Claude: Anthropic Console. Wir haben diesen Prompt-Generator in unserem ersten Treffen der Initiative „KI-Kompass für Mediatoren, Coaches und Berater“ vorgestellt. Diese Anwendung hilft, qualitativ hochwertige, das heißt auch spezifische Prompts zu entwickeln.
6. Sie haben u.a. erzählt, dass Sie sich mittels KI auch mal als Prüfer im Staatsexamen für das Verwaltungsrecht – während einer Autofahrt – Prüfungsfragen aus zuvor hochgeladenen juristischen Aufsätzen haben generieren lassen. Kann KI zukünftig auch ein Modell sein, sich schnell und zuverlässig fachfremde juristische Themen zu erschließen?
Ich habe mich auf das Prüfungsgespräch thematisch vorbereitet, nicht die Prüfungsfragen generieren lassen. Das faszinierende an der Vorgehensweise ist die Effizienz, da ich einen kompetenten Gesprächspartner an meiner Seite hatte. Mit ihm konnte ich mich auf die Prüfung einstimmen.
Sprachmodelle sind keine Wahrheitsmodelle und für Forschungsaufgaben nicht ohne Weiteres zuverlässig zu nutzen. Es bedarf schon konkret konfigurierter KI-Anwendungen, die solche Aufgaben übernehmen könnten. Das wird sicher bald der Fall sein. Derartige KI-Assistenten werden zukünftig auch fachlich versiert sein.
Für die Juristenwelt habe ich hier erst kürzlich von dem Berliner Startup-Unternehmen Xayn gehört, das genau an diesen Fragestellungen arbeitet. Die Recherchezeit für juristische Sachverhalte wird mit Sicherheit drastisch gekürzt werden – und womöglich auch komplette Subsumptionen in Minuten möglich machen.
7. Recherchen und Ergebnisse der KI auf juristischem Gebiet müssen inhaltlich richtig sein. Wie kann sich der Anwender vor sog. Halluzinationen oder falschen Auskünften schützen?
Das hängt auch vom Schutzbedarf ab. Ein Fachexperte benötigt weniger Schutz als ein Laie, weil er kritischer und genauer die Auskünfte zu prüfen in der Lage ist. Dennoch benötigt auch der Fachexperte gute Werkzeuge für die Recherchearbeit. Eine dafür konkret zugeschnittene KI wird wohl Grundvoraussetzung sein, sich auf die Richtigkeit verlassen zu dürfen. Aber wie auch sonst gilt für maschinelle Halluzinationen dasselbe wir für menschliche Irrtümer: Gefeit ist man nie vollständig und für immer!
8. Zum Schluss: Chat-GPT & Co sind wohl bislang noch keine Ersatz-Juristen. Wird die Rechtsfindung an den Gerichten zukünftig ohne KI noch funktionieren?
Nein, wird sie nicht. KI ist zwar nicht dafür da, das Recht in materieller Hinsicht zu finden. Recht bleibt Menschen zurechenbar, weil es eine Entscheidung ist.
Aber KI-Anwendungen werden unumgänglich sein für die Justiz insgesamt, die den Prozess der Rechtsfindung und Rechtsprechung in all ihrer Komplexität organisieren muss – und zwar auf eine Art und Weise, die einladend gestaltet sein muss. KI könnte also helfen, dem „Abwanderungsprozess von deutschen Gerichten“, den die Rückgänge der Eingangszahlen bei deutschen Gerichten belegen, zu begegnen.
Herr Prof. Dr. Weigel – Vielen Dank für das Interview!



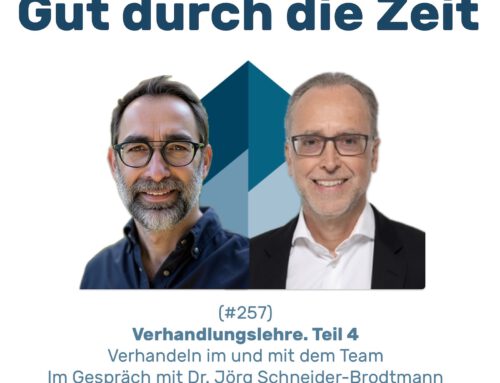

How did Prof. Dr. Sascha Weigel’s professional background lead him from the world of law to the field of mediation and the use of artificial intelligence in mediation?