INKOVEMA-Podcast „Gut durch die Zeit“
#201 GddZ – Das vertikale und das horizontale Kommunikationssystem
Wie sich Kommunikationsbemühte ignorieren – und eskalieren.
Im Gespräch mit Dr. Peter Modler
Dr. Peter Modler: Unternehmensberater, Coach und Bestsellerauto. Seit 1998 betreibt er eine eigene Unternehmensberatung in Freiburg im Breisgau mit Schwerpunkt auf Firmensanierungen und Coaching und Führungskräfteentwicklung.
Gut durch die Zeit.
Der Podcast rund um Mediation, Konflikt-Coaching und Organisationsberatung.
Kapitel
0:04 – Willkommen zum Podcast
1:36 – Über Kommunikationssysteme
6:38 – Von Akademikern und Praktikern
11:56 – Kommunikationsmuster im Alltag
17:56 – Rang und Revier
23:43 – Die Macht der Ranganerkennung
33:30 – Die Zweisprachigkeit von Führungskräften
35:25 – Politische Kommunikation verstehen
38:46 – Bedeutung nonverbaler Kommunikation
42:02 – Eskalationsstufen im Vertikalen System
44:16 – Ausblick auf die nächste Episode
Inhaltliche Zusammenfassung
In dieser Episode des Podcasts „Gut durch die Zeit“ beleuchte ich mit Dr. Peter Modler das komplexe Thema der verbalen Auseinandersetzungen und Konflikte im Kontext unterschiedlicher Kommunikationssysteme. Unser Gespräch zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für die Dynamik zwischen horizontalen und vertikalen Kommunikationsmustern zu entwickeln und wie diese Muster oft zu Missverständnissen und Eskalationen führen können.
Dr. Modler bringt eine interessante Perspektive mit, die auf seinen vielfältigen Erfahrungen beruht. Nachdem er aus einer handwerklichen und akademischen Karriere kommt, hat er ein tiefes Verständnis für die verschiedenen Kommunikationsstile entwickelt, die in unterschiedlichen sozialen und beruflichen Kontexten entstehen. Wir diskutieren, wie er als Akademiker auf der Baustelle gelernt hat, dass die sprachlichen Muster und Kommunikationsformen vor Ort völlig anders sind, als das, was ihm aus der akademischen Welt vertraut war. Hier wird deutlich, dass die unterschiedlichen Herangehensweisen an Kommunikation nicht unbedingt negativ sind, sondern vielmehr unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen spiegeln.
Ein zentrales Thema unserer Diskussion ist das Konzept von Rang und Revier in Kommunikationssystemen. Dr. Modler erklärt, dass vertikale Kommunikatoren primär nach Rangklärungen streben, während horizontale Kommunikatoren mehr Wert auf Zugehörigkeit und Inhalte legen. Dies führt häufig zu Missverständnissen, wenn beispielsweise eine Oberärztin versucht, in einer Besprechung produktiv zu kommunizieren, während ihr Vorgesetzter signalisiert, dass die Rangordnung ihm wichtiger ist als die tatsächlichen Inhalte des Gesprächs. Anhand von anschaulichen Beispielen aus seinem beruflichen Alltag wird klar, wie essenziell das Verständnis dieser dynamischen Effekte für die erfolgreiche Kommunikation ist.
Im Verlaufe der Episode arbeiten wir heraus, wie wichtig es ist, als Führungskraft die Fähigkeit zur „zweisprachigen“ Kommunikation zu entwickeln, die es ermöglicht, zwischen horizontalen und vertikalen Mustern zu navigieren. Sie beschreibt die Widersprüche, die entstehen, wenn unterschiedliche Systeme aufeinanderprallen. Es wird klar, dass eine effiziente Kommunikation nicht nur Wissen über die jeweils andere Seite erfordert, sondern auch eine Haltung des Respekts und ein echtes Interesse daran, die Perspektiven des anderen zu verstehen.
Wir beleuchten auch, wie persönliche und gesellschaftliche Polarisation in der Kommunikation entsteht und wie diese Elemente im Unternehmenskontext zu ineffizienten Besprechungen und schlechter Teamdynamik führen können. Dr. Modler stellt fest, dass der Schlüssel zur Überwindung dieser Herausforderungen oft darin liegt, die eigene Blase zu verlassen und den Dialog mit unterschiedlichen Kommunikationsmustern aktiv zu suchen, anstatt sie zu verurteilen oder zu ignorieren.
Abschließend sprechen wir darüber, wie jeder von uns von einer bewussteren Auseinandersetzung mit unseren eigenen Kommunikationsmustern und der Bereitschaft profitieren kann, die von anderen zu verstehen. Diese Episode bietet nicht nur wertvolle Einsichten für Führungskräfte und Kommunikatoren, sondern auch praktische Anregungen dafür, wie wir in unserem täglichen Leben konstruktiver miteinander sprechen können.
Unsere Ausbildung in Mediation und Konfliktmanagement in der Wirtschafts- und Arbeitswelt,
geleitet von Prof. Dr. Sascha Weigel.
Neustart jeweils jährlich im März und Oktober.
Jetzt für den nächsten Kurs anmelden!
Mehr Informationen hier...Ursprünge Deborah Tannen:
Das publizistische Werk von Dr. Peter Modler baut maßgeblich auf die Untersuchungen von Prof. Deborah Tannen aus den USA auf. Deborah Tannen ist eine renommierte amerikanische Soziolinguistin und Bestsellerautorin, die sich intensiv mit Kommunikationsmustern zwischen Männern und Frauen auseinandergesetzt hat. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen:
- Du kannst mich einfach nicht verstehen: Warum Männer und Frauen aneinander vorbeireden (1990): Dieses Buch untersucht die unterschiedlichen Kommunikationsstile von Männern und Frauen und wie diese zu Missverständnissen führen können. Es stand fast vier Jahre auf der Bestsellerliste der New York Times und wurde in 30 Sprachen übersetzt. WIKIPEDIA
- Das hab‘ ich nicht gesagt! Kommunikationsprobleme im Alltag (1986): Tannen analysiert hier, wie unterschiedliche Gesprächsstile Beziehungen beeinflussen und zu Missverständnissen führen können.
- Job-Talk. Wie Frauen und Männer am Arbeitsplatz miteinander reden (1994): In diesem Werk beleuchtet sie die Kommunikationsdynamiken am Arbeitsplatz und wie Geschlechterunterschiede die Interaktion beeinflussen.
- Laß uns richtig streiten. Vom kreativen Umgang mit nützlichen Widersprüchen (1998): Tannen diskutiert hier den konstruktiven Umgang mit Konflikten und wie unterschiedliche Streitkulturen zu besseren Ergebnissen führen können.
Zusätzlich zu diesen populärwissenschaftlichen Büchern hat Tannen zahlreiche wissenschaftliche Publikationen verfasst, darunter „Conversational Style: Analyzing Talk Among Friends“ (1984) und „Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse“ (1989). DEBORAH TANNEN
Ihre Arbeiten haben maßgeblich dazu beigetragen, das Verständnis für geschlechtsspezifische Kommunikationsstile zu vertiefen und die Bedeutung von Sprache in zwischenmenschlichen Beziehungen hervorzuheben.
Organisationsmediation ist die Bearbeitung von Konflikten, die in der Wirtschafts -und Arbeitswelt aufkommen. Sie findet in, mit und für die Organisation statt – indem den relevanten Organisationsmitgliedern eine angemessene Bearbeitung der Konflikte ermöglicht wird.
Wir bilden Sie dafür aus oder professionalisieren Ihre mediatorische, konfliktberaterische Vorgehensweise. Wir starten unsere Fortbildungsreihe regelmäßig im März eines Jahres.
Mehr Informationen hier...Vollständige Transkription:
[0:00]Eine Führungskraft, die ihren Job wirklich gut macht, die sollte aus meiner Sicht zweigleisig sein.
[0:05]Und zwar egal, welches Heimatsystem zu haben. Ob es jemand ist, der horizontal kommuniziert oder ob es jemand ist, der vertikal kommuniziert. Herzlich willkommen zum Podcast Akut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von INKOVEMA. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge.
[0:25]In der heutigen Folge wollen wir uns mit verbalen Auseinandersetzungen beschäftigen. Also im Grunde genommen das, was wir einen Konflikt nennen. Und dann ein Kommunikationskonzept uns zu Gemüte führen, das mein heutiger Podcast-Gast für die deutschsprachige Welt ausformuliert hat. In Anlehnung an ein schon etwas älteres Kommunikationskonzept aus Amerika. Aber das ganz interessante Einsichten erhält, Weshalb? Zuweilen die Personen eines Kommunikationssystems so völlig untergehen in der Auseinandersetzung gegen die Personen, die das andere Kommunikationssystem nutzen. Und bevor wir darauf inhaltlich eingehen, begrüße ich zunächst hier im Podcaststudio Dr. Peter Modler. Hallo. Hallo Herr Weigel. Sie haben in den letzten Jahren sich mit diesem Konzept des vertikalen und horizontalen Kommunikationssystems auseinandergesetzt, Sie haben dazu mehrere Bücher geschrieben, spezielle Trainings, auch speziell für Frauen. Und es ist nicht unbedingt der Ursprung Ihrer Tätigkeit. Sie kommen eigentlich aus ganz anderen Bereichen.
[1:33]Und daher zunächst mal ein paar Worte zu Ihnen. Wie sind Sie dazu gekommen? Und was ist für Sie das Faszinierende daran, dass Sie sich mit diesem Thema des horizontalen, vertikalen Kommunikationssystems und damit mit Konflikteskalation beschäftigen?
[1:48]Naja, ich habe in meinem eigenen Berufsleben sehr unterschiedliche gruppenspezifische Kommunikationseigentümlichkeiten kennengelernt. Ich habe eine Weile auf dem Bau gearbeitet, ich habe eine bautechnische Ausbildung als Zimmermann. Das heißt, ich habe als Akademiker, ich hatte nämlich vorher bereits studiert, ich kam als Akademiker auf die Baustellen. Ich war 25, ich war den akademischen Argumentations- und Höflichkeits-Slang gewohnt, kam dann auf die Baustellen und musste merken, dass die Leute auf diesen Baustellen in einer völlig anderen, mir total fremden Weise kommunizieren. Was mich am Anfang sehr irritiert hat, bis ich dann irgendwann mal kapiert habe, dass da kaum irgendwas abträglich gemeint ist, nur die Muster der Kommunikation sind eben völlig anders. Also Sie merkten, dass Sie es nicht persönlich nehmen müssen, wenn Sie dort etwas ruppig angegangen wurden?
[2:42]Ganz genau. Ich weiß heute noch, ich musste Probearbeiten, um mir überhaupt eine Lehrstelle verdienen zu müssen, also zwei Wochen gratis auf dem Dach. Und da weiß ich noch, am ersten Arbeitstag, als ich da angefangen habe, alle fanden es ein bisschen komisch, dass ein Studierter mit 25 jetzt da eine Lehrstelle will. Am ersten Tag, als ich dann da ein Werkzeug nach dem anderen gekriegt habe, habe ich mich für jedes Werkzeug bedankt. Also eine Säge gekriegt, danke. Eine Zange gekriegt, danke. Einen Schraubenschlüssel gekriegt, danke. Bis mir der Polier gesagt hat, noch ein Danke. Und ich hau dir so auf die Fresse, dass es dir vergeht. Spätestens da war mir klar.
…Ich komme aus dem Erzgebirge, ich habe gerade einige Flashbacks.
[3:24]Und Sie haben es nicht persönlich genommen? Also Sie haben sich dann nicht entschuldigt und gesagt, danke für den Hinweis.
[3:32]Naja, also jedenfalls war es irritierend für einen Akademiker. Mit der Zeit habe ich dann einfach verstanden, dass die Muster, die sprachlichen Muster, die in diesem Kontext angewandt werden, eben einfach völlig andere sprachliche Muster sind, aber gar nichts damit zu tun haben, dass mich da jemand fertig machen will. Sondern das waren eben Muster. Und wenn ich mich auf diese Muster eingelassen habe, da konnte ich da sehr gut leben. Also ich habe mit den Kollegen ein ganz hervorragendes Verhältnis gehabt. Es gibt da ja auf dem Bau dann, vor allem wenn sie auf dem Dach arbeiten, eine Menge Situationen. Da hängt ihr Überleben davon ab, dass sie anderen Leuten blind vertrauen. Das war auch so. Also die Loyalität und die Solidarität war sehr groß, aber mit vollkommen anderen kommunikativen Tools. Nachdem ich dann auf dem Bau gearbeitet habe, habe ich meine Promotion fertig gemacht. Bin dann als Quereinsteiger Geschäftsführer von einem großen Verlagshaus geworden. Das ist jetzt alles schon wieder 30 Jahre, vielleicht sogar 40. Vielleicht sind ja einige Akademiker auch unten zuhören. Woran haben Sie promoviert? Ich habe in katholischer Theologie promoviert, aber nie aktiv als Theologe gearbeitet. Wobei ich für das Studium selbst bis heute dankbar bin, weil diese geisteswissenschaftlichen Studien einem in der Regel, vor allem, wenn man dann in Führungspositionen arbeitet.
[4:51]Einen ganz enormen Horizont eröffnen, den Sie mit einem Schmalspurstudium, ich hoffe, die BWLer verzeihen mir das jetzt, wenn Sie mit einem BWL-Studium in eine Firmenleitung gehen, dann ist das eben ein riesiger Unterschied, weil Sie von vornherein in Gewinn- und Verlustrechnungen denken, oder in Betriebswirtschaftlichen Kennziffern. Während Sie als Geisteswissenschaftler reinkommen, müssen Sie sich das zwar aneignen, Aber sie denken sowieso viel langfristiger. Also ein Jahr bedeutet für einen Geisteswissenschaftler was anderes als für einen BWLer. Insofern würde ich mal die kühne These nebenbei erwähnen, Geisteswissenschaftler in Führungspositionen können leichter strategisch denken. Ich war da relativ erfolgreich, die Firma dann komplett umstrukturieren müssen. Und weil das sich rumgesprochen hat, wie erfolgreich ich damit war, gab es dann schon die ersten Beratungsanfragen anderer Firmen. Und irgendwann wurden die so viel, dass ich dann komplett umgestiegen bin.
[5:46]Beratungsanfragen hinsichtlich Ihrer BWL-Kenntnisse beim Umstrukturieren von Firmen oder sozusagen des Umgangs mit so einem Wechsel innerhalb einer Firma, so einem Change? Es ging eigentlich um die Restrukturierungen. Also ich habe die Firma restrukturiert erfolgreich. Nachdem sich das rumgesprochen hatte, kamen andere Firmen und wollten auch sowas haben. Die Restrukturierung war deswegen erfolgreich, weil die im Gegensatz zum Status vorher sich ganz konsequent nach Märkten ausgerichtet hat. Also Marktanalysen gemacht und dann die Firma auf diese Märkte hin strukturiert. Und genau das wollte dann eine Firma nach der anderen außerhalb meines damals aktuellen Arbeitgebers auch haben. Und so irgendwann waren die Anfragen so viel, dass ich dann meine eigene Unternehmensberatung gegründet habe. Es ist auch schon wieder viele Jahre her. Also auch den Markt ausgerichtet. Das habe ich vor einigen Jahren nicht mehr gemacht, die Sanierungen.
[6:39]Sondern habe mich völlig konzentriert auf die Begleitung von Führungskräften in Krisensituationen.
[6:45]Und so sind dann auch meine Bücher entstanden. Und mit einem Thema, das sich durch die Bücher durchzieht, also auch wenn sie thematisch sich sozusagen unterschiedlichen Zielgruppen widmen, Moderatoren, Frauen, manchmal auch politischen Diskutanten oder zumindest Personen, die in verbalen Auseinandersetzungen agieren und jetzt nicht dort in den Dialog geraten wollen, sondern wirklich in der Diskussion bleiben, politische Debatten oder auch in Meetings, zieht sich dieses Kommunikationssystem durch, das Sie so mit vertikalem, horizontalem Kommunikationssystem beschreiben oder auch betiteln. Bevor wir da tiefer einsteigen, noch so den Punkt, Sie haben ja so unterschiedliche Disziplinen im Akademikerwesen aufgezeigt und Ihre Herkunft oder zumindest zeitweises Arbeiten auf dem Bau, auf dem Dach, das sind für Sie, wenn ich so sagen darf, nicht verschiedene Disziplinen einfach nur, sondern Sie machen einen klaren Schnitt zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern.
[7:41]Ja, so klar würde ich es vielleicht nicht machen. Es gibt ja nun auch mal eine Reihe von Akademikern, die nicht akademisch sozialisiert worden sind. Die Supermarktkassiererin, die sich in ihrer Freizeit fortbildet, Realschulabschluss macht, dann auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur und dann irgendwann studiert, die ist ja da auch irgendwann Akademikerin, hat aber einen völlig anderen Hintergrund als jemand, der aus einer Akademikerfamilie kommt und keine Ahnung hat, wie es im Supermarkt an der Kasse zugeht. Also man muss das eine Kommunikationssystem, was man mit Sicherheit nicht in der Universität lernt, das muss man erlebt haben und sich darin bewegt haben, um es nachvollziehen zu können?
[8:19]Also ich glaube gar nicht mal, dass man das alles selber erlebt haben muss, aber was man lernen kann und was ich auch versuche in meinen Workshops weiterzugeben, ich sollte eine Wachheit und eine vorurteilslose Offenheit dafür haben und nicht deswegen etwas runtermachen, weil es nicht in meine Muster passt. Also wenn ich es ausblende, dann blende ich einfach Kommunikationsinhalte aus, das Konsequenzen haben wird. In einem meiner Bücher mit Ignoranten sprechen, da heißt ja der Untertitel, Wer nur argumentiert, verliert. Das ist so ein Klassiker. Also da treffen zwei Seiten aufeinander. Die eine Seite bringt in schnellster Diktion ein Argument nach dem anderen und hält diese Art der Kommunikation für selbstverständlich und selbsterklärend, während auf der anderen Seite große Pausen entstehen. Und dann ganz einfache Satzkonstruktionen verwendet werden, also Argument, Argument, Argument und auf der anderen Seite sagt dann jemand, nö, blöde Maus und dann sagt er, ist doch Quatsch.
[9:23]Irgendwie so, ja, und so. Und dann, was heißt das dann für die Seite, die da gewohnt ist, dass da argumentativ vorgegangen wird, denkt sich dann, ja, der ist halt ein bisschen beschränkt oder der ist halt doof, der ist halt ignorant.
[9:34]Statt wahrzunehmen, dass das, was diese andere Seite macht, auch Kommunikation ist, nur halt keine schnell argumentative Argumentationskette, die diese akademisch gebildete Seite jahrzehntelang trainiert hat. Deswegen ist es keine schlechte Kommunikation, es ist eine andere. Das gucken wir uns genauer an, weil als dieses Buch geschrieben war, war irgendwie klar, worum es da ging. Es war so in der Zeit des Aufkommens von Donald Trump. Man hat verzweifelt versucht zu verstehen, was da passiert. Man hat sich lustig drüber gemacht, wie er in Debatten ausschaut, wie er diskutiert und dennoch schien es so, dass er Punkte gemacht hat. Und das war so ein bisschen das Aufkommen. Es wurde irgendwie klar, wer ist der Ignorant oder wer sind die Ignoranten?
[10:23]Jetzt habe ich ja den Eindruck auch, dass sie, wenn wir das ausblenden würden, sage ich jetzt mal, die Akademiker, Klicke, auch die Politiker, die großteils akademisch gebildet sind, dann sind das ja auch Ignoranten. Also Ignoranten haben wir irgendwie auf beiden Seiten, sozusagen der übergreifende Thomas. Aber es scheint Unterschiede zu geben im Ignorieren. Wenn Sie erlauben, ich würde mal ein Beispiel erzählen, dass man vor ein paar Monaten begegnet ist. Weil wir können hier viel über Trump reden. Klar, der zieht unsere Aufmerksamkeit enorm auf sich, aber in Wirklichkeit geht es ja nicht um Trump. Also es gibt eine Menge dieser Trump-Figuren, selbstverständlich auch in deutschen Firmen und Unternehmen und übrigens auch in Hochschulen. Die heißen halt anders, verhalten sich aber ähnlich. Die Szene, die ich erzähle, bildet in einer Klinik, hoch angesehene Klinik.
[11:09]Und einmal in der Woche trifft sich der Klinikchef mit der Oberärztin zum Jurfix. Diese Oberärztin kommt in sein Büro rein mit einer langen Liste von Themen, die sie mit ihm besprechen will oder wo sie seine Entscheidung braucht. Dieser Klinikchef hat nie irgendwas auf dem Tisch liegen, wenn die reinkommt. Es ist immer ein fester Termin. Es ist immer 15 Uhr, also es ist nicht überraschend für ihn, aber wenn die dann reinkommt, steht er noch an seinem Schreibtisch und telefoniert. Oder er fängt sogar an zu telefonieren, wenn sie reinkommt. Naja, gut, also ein bisschen blöd. Dann wedelt er da so mit seiner Hand, soll sich hinsetzen. Dann setzt sich die Frau, was wahrscheinlich der erste Fehler war, aber sie setzt sich und dann bequemt sich der Chef auch an den Tisch zu kommen,
[11:51]setzt sich dazu, flätzt sich in seinen Sessel rein und sagt nur und. Und dann fängt die brav an, entsprechend ihrer Frageliste oder Themenliste zu berichten. Was ist jetzt in einer Woche passiert? Welche Probleme sind aufgetaucht? Was braucht sie für Entscheidungen mittendrin? Sie hat die ganze Zeit das Gefühl, er hört ihr nicht richtig zu. Sie thematisiert es aber nicht. Sie findet es auch zu beschämend, das zu thematisieren. Irgendwann holt dieser Typ einen Tacker vom Schreibtisch, setzt sich hin, klappt den Tacker auf, zieht eine Tackernadel raus, während sie weiterspricht und fängt an, sich mit dieser aufgebogenen Tackernadel die Fingernägel sauber zu machen. Das findet sie super peinlich. Peinlich?
[12:33]Aber sie findet sein Verhalten, sie ist im Grunde, schämt sie sich fremd für diesen lächerlichen Act von dem. Aber sie ignoriert es und bleibt an ihrer Themenliste. Er sagt immer nur, während er sich die Fingernägel sauber macht, immer nur der hmm, hmm, hmm.
[12:48]Und die arme Frau rätselt, was sie schon wieder falsch gemacht hat. Ja, und das geht eben wochenlang so. Also die kam mit in einem Workshop, hat diese Szene erzählt, eine dieser vielen Szenen, die man dann da so hört, was in Firmen kommunikativ abläuft, die einem im Grunde den Schuh ausziehen vor Fremdschamen.
[13:06]Aber das Typische für jemanden aus ihrem System, das ist jemand, der aus dem horizontalen System kommt, dieser Oberärztin, das Typische ist, dass man in so einer Situation in eine solche Hilflosigkeit gerät, dass man das dann lieber ignoriert, weitermacht mit dem eigenen System, auch wenn es überhaupt nichts nützt. Und in dem Fall hat es auch gar nichts genützt. Also die Stunde war vorbei, der Chef beendet das Gespräch und sagt, ja, Stunde vorbei, danke. Sie hat praktisch nichts gehabt davon. Er hat ihr auch nie zugehört. Dann geht sie raus und geht und hat schon Schiss vor der nächsten Woche, wo das Ganze wieder ablaufen wird. Da treffen diese zwei Systeme, die Sie angesprochen haben, auf eine ganz miese Weise aufeinander. Nämlich diese horizontalen Leute, deren System durch zwei Achsen definiert wird. Die eine Achse ist die Achse der Zugehörigkeit. Die andere Achse ist die Achse der Inhalte. Das bedeutet, dass dieses System zum Beispiel an einer Besprechung ab der ersten Sekunde im Inhaltsmodus sich befindet. Das andere System hat aber nicht diese beiden Achsen. Das andere System, das komplementäre System, das sogenannte vertikale System, folgt den Achsen Rang und Revier. Hört sich ein bisschen archaisch an und natürlich kann man sich als Akademiker sofort fragen, okay, wenn da Rang und Revier steht, wo sind denn da die Inhalte?
[14:33]Genau, die Unterfütterungssinn. Der Oberarzt, der Chef sollte also irgendwann mal auch Inhalt geplant haben. Ja, es ist jedenfalls zunächst schon mal klar, wenn da das eine System mit Zugehörigkeitsbotschaften und Inhaltsbereitschaft reingeht in die Auseinandersetzung, das andere System aber mit einem Rang- und Revierbedürfnis, dann ist eigentlich vorherzusehen, dass ohne Dolmetscher werden wir ein Problem kriegen. Die Deutung wäre völlig in die Irre führend, wenn ich jetzt anfangen würde, naja, sie gehört halt noch nicht zu der Gruppe von Chefinnen. Und das macht er ihr deutlich. Also Zugehörigkeit ist, also dass sie nicht dazugehört, ist nicht die Botschaft aus seinem vertikalen System. Naja, ich würde es mal so sagen, diese beiden Systeme, wenn die in diesen Raum reinkommen, die haben andere Bedürfnisse und die verhalten sich auch anders.
[15:26]Die Frau geht davon aus, ist eigentlich egal, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist, es gibt auch horizontal kommunizierende Männer. Diese Frau jedenfalls geht rein und denkt sich, wir haben ja jetzt unseren Besprechungstermin, also habe ich mich vorbereitet, also reden wir jetzt über Inhalte. Ich komme rein und bin zack im Inhaltsmodus. Und ich werde geprüft an den Inhalten, ich muss jetzt gut sein. Und ich bin auch bereit, ihm ab der ersten Sekunde, wenn ich die Schwelle zu diesem Raum überschreite, gebe ich dem Zugehörigkeitszeichen. Also ich lächle, ich grüße freundlich, ich behalte mich nicht. Ah, da ist Zugehörigkeit drin. Das ist Zugehörigkeit, weil das machen Horizontale. Kommt nicht zu spät. Man kommt nicht zu spät. Grundlos in einen Baum reinlächeln mit lauter fremden Leuten, das machen Horizontale. Vertikal machen das nicht. Die können auch lächeln, die lächeln aber dann, wenn sie es angebracht finden.
[16:16]Wenn sie ein bisschen nach unten lächeln können. Das wäre dann nochmal eine Variante. Kommt die also mit ihren Zugehörigkeitszeichen, mit ihrer Inhaltsbereitschaft rein und denkt, die andere Seite ist auch so wie ich und hat dieselben Muster wie ich und erwartet also von der anderen Seite auch Zugehörigkeitszeichen und auch ein inhaltliches Eingehen auf die Fragen. Die andere Seite ihrerseits befindet sich in einem anderen System und in einem anderen Kommunikationsmodus. Die andere Seite ist interessiert an Rangklärungen und an Revierbotschaften. Und das hätte die Oberärztin eigentlich schon daran sehen können, an dieser merkwürdigen kleinen Theaterszene, dass der telefoniert an seinem Schreibtisch und sie sich an einen anderen Tisch, nämlich an den Besprechungstisch setzen soll. Und dann hört er irgendwann mal auf, hätte er ja nicht machen müssen, hat er gewusst, dass es ein vereinbarter Termin war. Nein, er macht also ein kleines Theaterstück und läuft dann durch den Raum hin zu diesem Tisch und setzt sich dann hin und als nächstes schiebt er den Schul ein bisschen zurück und fläzt sich da rein. Das sind Regierbotschaften.
[17:19]Das heißt, ich will, dass du mein Revier anerkennst. Die zweite Ebene, die dir eine riesige Rolle spielt, ist eine Ebene, die er nicht ausspricht, die sich dann im Workshop bei mir herausgestellt hat, weil diese Oberärztin ist eine extrem erfolgreiche Oberärztin. Einmal an dieser Stelle, ich möchte, dass du das anerkennst, das ist mein Revier. Woran würde der merken und würde er das honorieren, dass das anerkannt wird? Oder ist das auch etwas, wo man sich jetzt hilflos bemühen kann, aber man schafft es nicht, sozusagen da Gleichklang herzustellen?
[17:52]Also zunächst mal ist die Regel, ein Revier beginnt an der Türschwelle. Das heißt, wenn ich das Büro von jemand anderem betrete, betrete ich ein fremdes Revier. Sollte mir klar sein, für dieses Betreten dieses fremdes Revier brauche ich die Erlaubnis des Reviereigentümers. Das heißt, Tür aufmachen, reingehen und sich dann irgendwo hinsetzen, ist keine Revieranerkennung. Anders wäre es, wenn ich klopfe und warte, falls die Tür überhaupt zu ist, weil in manchen Kontexten steht sie ja auf, gehen wir mal davon aus, dass die Tür aufsteht, dann klopfe ich am besten am Türrahmen und frage, obwohl der Termin vereinbart war.
[18:30]Frage ich, geht’s jetzt? Oder passt’s jetzt für Sie? Oder irgendwie sowas. Das heißt für einen Vertikalen nicht einfach nur, da ist jemand höflich, sondern das heißt für den, okay, da kapiert jemand, dass das nicht sein Revier ist und dass er um Erlaubnis fragen muss. Und die Termin und die Vereinbarung, man trifft sich im Büro, ändert daran gar nichts? Ändert gar nichts daran. Dann komme ich also rein, nachdem mir der Revierinhaberin die Erlaubnis gegeben hat, dann komme ich rein, dann werde ich wahrscheinlich nochmal eine Kommentierung meines Hereingehens kriegen. Die andere Seite wird entweder sagen, ja klar, komm rein, setz dich doch oder vielleicht sagt sie sogar, setz dich am besten hierhin. Das wäre der positive Kommentar oder sie würde einen negativen Kommentar sagen. Zum Beispiel, warte noch einen Moment oder jetzt geht’s nicht.
[19:20]Oder, kommt auch vor, du kannst ruhig stehen bleiben, das wird jetzt ganz kurz. Gehen wir mal davon aus, die Revierfrage ist geklärt. Nur der Indikator für jemand Horizontalen, dass da Revier eine Rolle spielt, sind meistens solche kleinen Revieraktionen, die man sehen könnte, wenn man darauf achtet. So, jetzt ist der Hintergrund der ganzen Sache, und das habe ich erst rausgekriegt in der Befragung der Klientin. Der Hintergrund ist, das ist eine ehrgeizige Oberärztin, medizinisch ganz hervorragend ausgebildet, mit einem ganz großartigen Rekord über ihre operativen Erfolge. Im Grunde ist sie ein medizinischer Star an dieser Klinik. Während der Chef nicht besonders gut ist als Mediziner. Ist halt der Chef. Aber wie kommt das?
[20:01]Ja gut, naja, das passiert laufend. Das meine ich sozusagen, das scheint Bedeutung zu haben, dass man so agiert auch. Wenn man sagt, der war nicht irgendwann früher mal ein Star und lebt halt noch zufällig in diesem Chefbüro, sondern vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen beiden Dingen. Ja, nicht unbedingt. Also in diesem Fall gab es den Zusammenhang. Es hat es nur noch mal klarer gemacht. Warum? Weil ein vorgesetzter Chef, ein vertikaler Vorgesetzter oder eine vertikale Vorgesetzte, die fachlich auch noch schwach ist, die fühlt sich ja die ganze Zeit als eine Art Hochstapler, die Angst haben muss, enttarnt zu werden. Jetzt kommt dieser Überflieger und stellt im nächsten Meeting wieder so eine blöde Frage. Dann merken leider schon wieder alle, der Chef hat es nicht drauf. Der Chef checkt sich. Und diese arme horizontale Überfliegerin denkt, ich kriege noch mehr Anerkennung vom Chef, wenn ich immer noch mehr Leistung bringe. Was leider den entgegengesetzten Effekt hat, weil der Typ sich immer mehr in die Enge gedrängt fühlt.
[21:00]Okay, aber was für ein Bedürfnis hat dann so ein vertikaler Hochstapler? Am dringendsten. Was würde ihn beruhigen? Was macht ihn nicht mehr gefährlich? Weil solche Typen sind in der Regel ein gefährlicher Gegner in Organisationen. Ja, was ihn wahrscheinlich ziemlich schnell entwaffnet ist, wenn ich ihm den Rang anerkenne. Das heißt, die Lösung dieser Szene, wir spielen das ja meistens auch experimentell durch in Workshops, um solche Lösungen zu entwickeln. Die Lösung in dieser Szene war, sie kommt rein, sie klopft erst mal am Türrahmen, passt es jetzt, dann kommt sie rein, dann setzt sie sich nicht hin, sondern bleibt stehen, was kein Zeichen von Respektlosigkeit ist, aber auf ihn den Druck erhöht, dass er sein blödes Telefonat jetzt mal aufhört, ist dann auch ganz schnell zu Ende. Dann kommt er, setzt sich hin, er darf sich als Erster hinsetzen, das ist ja sein Revier, dann bietet er einen Stuhl, dann setzt er sich hin, okay.
[22:00]Dann sagt sie als allererstes, wenn er sie auffordert und dann sagt sie nicht sofort was Inhaltliches, dann macht sie das, was die Situation für diesen Vertikalen überhaupt erst aufschließt und kommunikabel macht. Sie sagt nämlich laut und deutlich, Sie sind der Klinikdirektor. Und dann sagt sie, was sie will, nämlich ich brauche jetzt Ihre Unterstützung bei den Themen, die jetzt kommen. Wir haben das nachgespielt mit einem Sparringspartner. Und der hatte überhaupt kein Problem, die ganze Zeit über diese arme Frau hinwegzugehen. Aber als die diesen Satz sagt, Sie sind der Klinikdirektor, da setzt er sich auf einmal ganz anders hin auf seinem Stuhl. Und die Botschaft ist nicht so sehr, ich nehme Sie jetzt in die Pflicht, jetzt zeigen Sie mal, dass Sie das auch sind, sondern schlichtweg, Sie sind es. Und es gibt keinen Grund zur Befürchtung, dass sich das durch meine Anwesenheit ändert. Hey, du, der diesen Podcast hört, vergiss nicht, ihn zu bewerten und eine Rückmeldung zu geben. Vielen Dank und jetzt geht’s weiter.
[23:07]Es gibt manchmal bei besonders erfolgreichen, horizontalen Kommunikateuren und intellektuell überlegenen Akteuren gegenüber so einem vertikalen Chef eine deutliche Hemmung, dem den Rang anzuerkennen. Also ich weiß doch, das ist ein Trottel, der hat es nicht drauf und jetzt soll ich dem sagen, Sie sind der Chef. Warum gibt es diese Hemmung? Die gibt es nämlich bei Vertikalen überhaupt nicht. Die gibt es deswegen, weil im horizontalen System eine Ranganerkennung immer verknüpft gedacht wird mit einer inhaltlichen Beurteilung. Also wenn ich dir sage, du bist der Chef, sage ich eigentlich, du bist ein guter Chef.
[23:44]Das ist im vertikalen System überhaupt nicht so, weil im vertikalen System wird so eine Ranganerkennung als rein formaler Akt verstanden. Also mit wichtig und mit Inhalt. Der Inhalt in der Anerkennung ist sozusagen bedeutsam. Also es genügt die formale Anerkennung. Der Inhalt spielt eigentlich keine Rolle. Also wenn ich jemandem sage, von dem ich weiß, er ist ein Trottel, ist aber leider mein Vorgesetzter. Wenn ich dem völlig unironisch anerkenne, Sie sind der Vorgesetzte. Sie sind die Chefin. Sie sind der Geschäftsführer.
[24:15]Dann wirkt es wie das Vorzeichen vor der Klammer in einem mathematischen Term. Also ich habe da so einen Term A plus B plus C, vorne eine Klammer, hinten eine Klammer. Wenn ich jetzt vor dieser Klammer ein Minus habe, dann verändert sich in dieser Klammer alles. Wenn ich vor der Klammer ein Plus habe, verändert sich nichts. Das ist der Schlüssel zum Klammerinhalt. Das Vorzeichen vor der Klammer, das ist für Vertikale in der Regel die Rangklärung. Und das Besondere ist im vertikalen System, eine Ranganerkennung ist nie verbunden mit einer inhaltlichen Qualifizierung. Die ist rein formal. Ich wiederhole bei dieser Ranganerkennung nur, was auf der Visitenkarte von dem steht oder was auf dem Türschild steht oder im Organigramm. Er ist halt der Klinikchef. Also sage ich, Sie sind der Klinikdirektor, obwohl ich weiß, medizinisch bist du eine Null. Egal, ich erkenne dir diesen Rang an. Ich thematisiere das auch nicht, auf gar keinen Fall, dass er medizinisch eine Null ist, sondern ich schließe die Situation auf, indem ich ihm diesen Rang anerkenne. Übrigens völlig unironisch. Wenn ich es ironisch mache, ist alles verloren. Ich erkenne ihm diesen Rang an. Wenn nötig, wenn ich das Gefühl habe, dass er mich nicht wahrnimmt, kann ich auch noch meinen Rang dazu stellen. Sie ist in der Klinik, Direktor. Pause.
[25:29]Ich bin die Oberärztin. Und dann kann ich inhaltlich werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er mir dann zuhört, ist fast 100 Prozent. Drehen wir die Szene mal ein paar Jahre nach vorne. Oberarzt oder Chefarzt ist im Ruhestand. Die Ärztin ist jetzt die Chefin. Es kommt ein junger Assistenzarzt dazu, der zwar auch studiert ist, aber doch auch so im vertikalen Kommunikationssystem sich beheimatet fühlt. Damit sozusagen das, was Sie unter Rang und Revier benennen, jetzt nicht vorschnell in Organisation und Hierarchie übersetzt wird, sondern das hat was mit den einzelnen Menschen zu tun. Wenn der sich jetzt so benimmt und wahrscheinlich nicht anklopft, bevor er reingeht, sondern einfach in der Tür steht, was heißt das sozusagen, Rang an Erkennung zu kommunizieren, wenn diejenige Person in der Organisation unter einem steht? Ist das dann wichtig oder ist das dann etwas, was sozusagen von alleine geklärt ist, der weiß, wo er hingehört? Herr Weigl, es ist gut, dass wir das ansprechen. Das ist nämlich nicht der Fall. Es ist übrigens auch bei Gleichrangigkeit nicht der Fall. Diese Rangfragen im Verhältnis vertikal-horizontal, die sind nicht nur relevant, wenn es ein Gefälle nach unten gibt. Die sind genauso relevant, wenn es ein Gefälle nach oben gibt. Oder sie sind sogar relevant, wenn es gar keine Gefälle gibt.
[26:47]Weil geklärt werden muss es für Vertikale. So oder so. Wir haben es also nicht mit Professionsfragen zu tun. Bin ich der bessere Arzt? Bin ich der bessere Jurist? Was habe ich für eine Note hinter dem Komma? und Organisation, ob ich jetzt wie viel Person ich führe und wie viel Gehalt ich bekomme und welchen Verantwortungsbereich ich trage, sondern wir haben es was damit zu tun, was Menschen mitbringen in die Kommunikation.
[27:10]Ja, es geht da einfach um unterschiedliche Bedürfnisse. Also man kann es vielleicht so sagen, das vertikale System hat ein Bedürfnis nach einer Landkarte. Die möchten eine Orientierung haben. Die wollen wissen, wo ist Norden. Und das machen sie über diese Rang- und Revierklärungsversuche. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, das geht ja nicht unendlich lang, wenn diese Phase abgeschlossen ist, können die super inhaltlich werden. Ah, okay.
[27:37]Da können die loyal und super konstruktiv werden. Wenn aber diese erste Phase der Rang- und Revierklärung nicht vorgenommen wird, dann kriege ich das Ticket nicht, mit dem ich in die U-Bahn komme. Ich komme nicht durchs Drehkreuz. Ich komme in das Meeting rein, voll auf die Inhalte vorbereitet. Und das erwarte ich auch, dass da gleich so geredet wird. Und dann machen da irgendwelche andere Leute, die kümmern sich noch um ganz andere Themen. Die regeln beim Fußball, die laufen durch den Raum und klimpern mit den Gläsern und den Flaschen auf den Tisch rum. Die stehen viel zu lang da. Eigentlich will die Sitzung ja anfangen. Irgendwas machen die ja. Und warum halten die das jetzt so auf? Weil aus deren Sicht die Eintrittskarte noch nicht gekauft worden ist. Nämlich eine Rang- und Revierklärung. Weil erst wenn die gelöst ist, dann kann dieses System inhaltlich werden. Diese Anlaufphase braucht das horizontale System nicht. Da mag ich sozusagen Ihre Erfahrungen seit den 80ern oder so, weil Sie einfach schon lange diese Branche miterlebt haben, die unter dem Bereich von Kommunikationstrainings und wie können wir besser kommunizieren, da hat sich ja viel Mühe gegeben, aber mir scheint, Das ist etwas, was vielleicht bisher oder lange Zeit so ist, das haben wir überwunden oder das haben wir dort gelassen, wo wir herkommen, aber das spielt dann keine Rolle mehr.
[29:02]Viele haben ja auch einen Lebensweg von der Kleinstadt in die Universitätsstadt und haben sozusagen die Dinge da zurückgelassen, von denen man auch sagen könnte.
[29:11]Es ist einfach die Höflichkeit, die sich gehört, das Revier des anderen anzuerkennen und dann klopft man halt erstmal an die Tür, ehe man eintritt. Wie kommt es, dass das in der Kommunikationswissenschaft praktisch unbeachtet blieb, wenn ich jetzt mal das ein bisschen überzeichnen darf? Ja, Herr Weigl, Sie haben schon recht. Also mein Eindruck ist, dass viele Kommunikationstrainings in Firmen und Organisationen eigentlich Einführungen in horizontales Kommunizieren sind, aber die vertikale Seite abgewertet wird oder komplett ausgeblendet wird, oft auch aus Hilflosigkeit, weil eine horizontale Seminarleiterin oder Seminarleiter, der die horizontalen Tools an vermutet horizontale Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergibt, in der Regel auch nicht richtig weiß, was ich jetzt mit vertikalen Störungen machen soll. Ich persönlich finde das jetzt nicht besonders kompliziert und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe für den Erfolg meiner Bücher, dass sich viele andere da nicht besonders drum kümmern. Ich verstehe es nur ehrlich gesagt nicht. Wenn ich beobachte, wie tatsächlich in Firmen kommuniziert wird, die einen hohen vertikalen Anteil haben, ich würde mal sagen, natürlich ist es ein bisschen branchenabhängig. Also je näher ich an den Maschinenbau komme, umso vertikaler wird es. Bei einem Autobauer oder in einer Stahlschmelze, ja da muss ich mich nicht wundern, wenn von morgens bis abends vertikal kommuniziert wird. Und wenn ich als horizontaler Hochargumentierer da reinkomme in einen Konflikt mit einem Vorarbeiter oder mit einem Vorstandsvorsitzenden, ganz egal.
[30:36]Da kann ich nicht davon ausgehen, dass der versteht, was ich mit einem horizontalen Kommunikationsmuster eigentlich möchte, weil der seinerseits davon ausgeht, die ganze Welt spricht vertikal.
[30:47]Andere Seite der Extreme wären dann Systeme, in denen flächendeckend horizontal kommuniziert wird. Das ist zum Beispiel der Pflege- und Sozialkontext. Das finde ich interessant, weil ich habe jetzt im Hinterkopf sozusagen zum Beispiel Großkanzleien gehabt oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
[31:04]Wo ich auch sofort sagen würde, dort wird der Rang sofort geklärt und zwar nicht über die Note im Examen, sondern über andere Kennzeichen. Das heißt, die sozialen Organisationen, also wo man sich stark um Verbesserung der Kommunikation bemüht. Ja, ich bin da voll bei Ihnen. Ich finde auch, dass Kommunikation verbessert werden sollte. Wir brauchen das auch dringend für sämtliche Wirtschaftszweige. Und das sagen ja viele, dass man das macht. Ja, wenn die eine Hälfte dabei außen vor gelassen wird, kann das nicht funktionieren. Okay, gut. Das heißt aber sozusagen, die, die sich bisher um Kommunikationstrainings und Verbesserungen der Kommunikation bemüht haben, sind anfällig gewesen, nur die eine Seite zu trainieren und zu betonen. Denn ich habe eher selten in der Großkanzlei Seminarangebote gesehen von Lernern, die ich Botschaft kennen. Herr Weigl, ich meine die, wie soll ich das sagen, also die Lehren der amerikanischen Psychologie aus den 70er Jahren, die dann mit einiger Zeitverzögerung zu uns gekommen sind, dazu würde auch Ruth Kohn gehören mit den Ich-Botschaften, Klammer auf.
[32:13]Wenn man bei Ruth Kohn nachliest, tatsächlich im Original nachliest, wie sie das gemeint hat mit den Ich-Botschaften, dann ist es viel differenzierter und fachlich nicht so summarisch abzuhaken, wie das inzwischen ihre Epigonen verbreiten. Wir reden ja von einem Wirtschaftskontext. Und in einem Wirtschaftskontext oder in einem organisationalen Kontext, da geht es ja darum, dass Ergebnisse erzielt werden müssen, oft auch noch unter Zeitdruck.
[32:36]Das heißt, es gibt einen gewissen Ergebnisdruck, einen gewissen Leistungsdruck. Ich meine, es ist gerade erst vor ein paar Tagen eine Untersuchung herausgekommen, warum die Arbeitsproduktivität in Deutschland sinkt. Vielleicht haben Sie es gelesen. Die Produktivität sinkt deutlich, obwohl die Zahl der geleisteten Stunden steigt. Also warum brauchen wir immer mehr Zeit bei der Arbeit, während die Produktivität sinkt? Und die Autoren der Studie kommen zum Ergebnis, das liegt an den ganzen völlig überflüssigen Besprechungen. Die Abstimmungsdichte, die wir inzwischen haben mit allen möglichen Kollegen, damit unbedingt auch noch alle im Boot sind, ist derartig hoch geworden. Ja, alle wollen nochmal mitreden und alle müssen mitgenommen werden. Dass wir immer schwächere Ergebnisse kriegen, weil das dauert natürlich viel zu lange und wir verschwenden viel zu viel Zeit damit. Worauf ich raus möchte, Herr Weigl, eine Führungskraft, die ihren Job wirklich gut macht,
[33:28]die sollte aus meiner Sicht zweisprachig sein. Und zwar egal, welches Heimatsystem sie hat. Ob das jemand ist, der horizontal kommuniziert oder ob es jemand ist, der vertikal kommuniziert. Aber beide sollten in der Lage sein, auch die Eigengesetzlichkeiten des anderen Systems zu kennen, ohne es abzuwerten und bei Bedarf zu nutzen.
[33:48]Also wenn ich ein vertikaler Chef bin und ich habe überwiegend horizontale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann sollte ich verstehen, was ich machen muss, um mit denen zu reden. Und dann kann ich nicht jedes Meeting mit einer Randklärung anfangen, weil dann sind die Horizontalen auf 180, das finden die peinlich und steinzeitlich und zurückgeblieben und es demotiviert die. Das sollte ich wissen als Vertikaler. Oder umgekehrt sollte ich wissen, wenn ich ein horizontaler Chef bin oder eine horizontale Chefin und ich arbeite in so einem vertikalen Kontext, Und ich fange jedes Meeting an mit Ich-Botschaften und wir reden jetzt alle mal darüber, wie es mir geht. Da ist bei den Vertikalen der Rollladen unten. Das wird ein mieses Meeting werden, aber die Chefin ist eben selber schuld.
[34:28]Alle in Therapie zu schicken ist einfach keine Lösung. Jedenfalls nicht in einem vertikalen Kontext. Jetzt haben wir das ja sozusagen durchaus so als gesellschaftliche Beobachtung, dass an aller Orten beschrieben wird von Polaritäten. Und es wird auch natürlich an diesen politischen Entwicklungen festgemacht, wo wir es zunächst im Fernsehen und in sozialen Medien in Amerika sehen. Jetzt sehen wir die Dinge hier in Deutschland, wo wir das schnell irgendwie den Eindruck bekommen, die einen interessieren sich für Inhalte, für die ist sozusagen von der Klimakrise bis zu Globalisierungsfragen etc. Inhaltlich bestimmt und die anderen scheinen das zu ignorieren und einfach weitermachen zu wollen wie bisher. Und Sie haben das ja ursprünglich sozusagen an diesem Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump festgemacht. Ich muss da noch mal kurz darauf zurückkommen, weil wir den Eindruck haben oder oft beschrieben wird, das übernimmt jetzt die gesamte Gesellschaft.
[35:25]Würden Sie sagen, dass das zum Stück weit auch ein Aneinandervorbeikommunizieren ist von diesen zwei Systemen? Also würden wir mit dieser Konzeption, die ja ursprünglich ein amerikanisches Konzept ist, ich werde das nochmal in den Shownotes auch verlinken, die Ursprünge, dass wir damit ein Stück weit klarer kommen und dass es nicht eine Polarisierung auf einem Kontinuum ist, also die eine Seite und die andere Seite, sondern dass dann wirklich zwei verschiedene Kommunikationssysteme auch im gesellschaftlichen miteinander um Anerkennung ringen. Ich habe ein bisschen Hemmungen, die große politische Erklärung aus dem Sack zu holen. Ich bin nur ein Unternehmensberater, der will, dass es meinen Klientinnen und Klienten besser geht mit ihren zum großen Teil miesen Situationen. Ich bin interessiert daran, dass.
[36:12]Kommunikation produktiv wird. Mein Eindruck ist, auch bei vielen politischen Auseinandersetzungen, die wir in Deutschland haben, aber nicht nur in Deutschland. Sie finden dieselben Muster in ganz Westeuropa, in Osteuropa auch. Asien wäre ein bisschen was anderes, aber diese Muster finden wir überall. Der entscheidende Schlüssel für das Aufbrechen dieser Muster ist das Verlassen der eigenen Blase, also feststellen, dass ich tatsächlich gewohnt bin, auf eine Weise zu kommunizieren, von der ich nicht annehmen darf, dass sie überall so verstanden wird und dass überall alle genauso auch mitmachen können. Ich lebe in einem kleinen Dorf mit 400 Einwohnern. Ich singe damit im Dorfchor. Zwei Plätze neben mir singt eine mir sehr liebe Sängerin. Die ist Kassiererin im Supermarkt. Okay, wenn ich mich mit der unterhalte, dann ist mir völlig klar, ich kann jetzt hier nicht meine gesamte akademische Bildung raushängen lassen und dann dauernd mit irgendwelchen elaborierten politischen Argumentationsketten Auf die Einreden. Weil ich nämlich schon viele Situationen mit dieser Frau erlebt habe, wo wir solidarisch waren und eine tiefe persönliche Beziehung haben konnten.
[37:20]Obwohl ihre Kommunikationsformen ganz andere sind als meine. Also warum sollte ich denn jetzt die Kommunikationseigentümlichkeiten dieser Supermarktkassiererin runtermachen, nur weil sie nicht Plato gelesen hat oder weil sie nicht gelernt hat, ein Argument im politisch direkten Diskurs nach dem anderen durchreflektiert vorzustellen? Warum sollte ich die runter machen? Wenn ich was sage und dann sehe ich, sie guckt mich so ein bisschen zweifelnd an und schüttelt so ein bisschen den Kopf, dann sollte ich nicht weiterreden. Dann sollte ich verstehen, dass sie jetzt gerade mit mir kommuniziert. Und dann sollte ich darauf eingehen. Den Hauptfehler oder das Haupthindernis auch für uns in Deutschland an politischer Kommunikation ist dieses Beharren auf dem eigenen Lager. Diese große Bereitschaft, die andere Seite so schnell moralisch abzuwerten, wenn die andere Muster verwendet. Also wenn jemand Pausen macht, langsam spricht, einfache Botschaften macht und mich dadurch aus dem Konzept bringt, dann ist die andere Seite doch nicht einfach ein Vollhorst. Dann sollte ich mal verstehen, als jemand, der den Anspruch hat, ich will kommunikativ sein, dann sollte ich mal entschlüsseln, dass die andere Seite mit mir gerade spricht.
[38:36]Obwohl sie kaum redet. Also Knigge hat in seinem berühmten Buch über den Umgang
[38:41]mit Menschen, Knigge hat dieses Buch damals in zwei Teile geteilt. Das eine war die gesprochene Sprache und das andere war die Gebärdensprache.
[38:51]Also zur Zeit von Knigge war es noch völlig selbstverständlich, dass die sogenannte Gebärdensprache, damit meint er, Bewegen im Raum, Gestik, Mimik, völlig gleichberechtigt ist, mit unserer verbalisiert geäußerten Sprache. Und wir haben inzwischen irgendwie uns abtrainiert in unseren ganzen akademischen Ausbildungen, dass es tatsächlich auch noch was anderes gibt als verbales, schnelles Herausfeuern von vielen Silben. Ich finde es sozusagen paradox, dass wir uns das abtrainiert haben oder dass man in die Gefahr kommt, das abzutrainieren, dass das Bedeutung hat. Gleichwohl wird immer wieder betont, wie bedeutsam das Nonverbale ist. Und mir scheint, das ist nochmal ein anderer Aspekt, dass es nicht nur nonverbal ist, sondern die beschreiben das als ja wirklich verkörpertes Kommunizieren. Also der Move-Talk, den Raum bearbeiten, hatten sie das mal so bezeichnet. Ich verwende den Begriff nonverbal nicht mehr. Und zwar einfach deswegen, weil das extreme Gegenüberstellungen behauptet und dabei ein Ideal vorausgesetzt wird. Das Ideal wäre dann verbal. Also verbal ist eigentlich das, was wirklich was wert ist.
[40:03]Aber dann gibt es da auch noch irgendwelche komischen Phänomene, die sind leider nicht verbal oder nonverbal, aber der Maßstab ist das Verbale. Das halte ich für einen Fehler. Das ist ja auch interessant, dass dort Rangfragen wieder rein sich schleichen in das horizontale System. Ja, also deswegen rede ich nicht von nonverbal, sondern vom Move Talk.
[40:23]Und Move Talk bedeutet, das ist wirklich ein sprachliches Element.
[40:29]Es ist ein ganz enorm wirksames sprachliches Element, das im vertikalen Kontext der höchsten Eskalationsstufe in Konflikten entspricht. Weil es ohne jedes Wort passiert, von Horizontalen in der Regel komplett unterschätzt wird. Also ich komme in den Raum rein, ich habe meinen Aktenordner unterm Arm und ich bin voll im Argumentationsmodus und jetzt warte ich darauf, dass es losgeht. So, jetzt komme ich da rein, da stehen zwei Leute, zu denen gehe ich hin, worauf der eine nach links weggeht.
[41:01]Und irgendwas in irgendeiner weit entfernten Ecke macht. Und der andere nach rechts. Und dann anfängt die Getränke auf dem Tisch zu sortieren, als ob die noch nicht sortiert wären. Und da sollte ich mir mal darüber klar sein, was jetzt gerade passiert. Weil da wird mit mir gesprochen. Und da kriege ich nämlich die Botschaft, wir wollen jetzt hier nicht mit dir verbal werden. Oder vielleicht sogar die Botschaft, wir ahnen schon, wie gut du vorbereitet bist und was für eine Position du da vertreten wirst. Aber das ist nicht unsere.
[41:30]Oder gehörst du hier überhaupt in das Meeting? Oder wir sind viel hochrangiger als du, du hast hier überhaupt nichts zu mehr. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, was damit gemeint wird. Nur ich sollte verstehen, dass da gerade eine Kommunikation stattfindet und nicht verzweifelt darauf warten, wann der erste verbale Begriff fällt. Also wichtig auch, da will ich noch mal den Kreis schließen auch, da geht es eben nicht um die Ablehnung der Inhalte, um die jetzt am Anfang gerungen
[41:58]wird, sondern den Schlüssel zum Miteinander kommunizieren finden. Das ist der Punkt, Herr Weigel. Also es gibt in diesem vertikalen System, wird in drei Stufen eskaliert. Die unterste Stufe ist der sogenannte High Talk. High Talk ist ein elaboriertes, intellektuelles, begründendes Sprechen, in dem viel Wissen, vielleicht sogar Fachbildung vorkommt. Und wenn die andere Seite auch High Talk macht, gibt es ja in der Regel wenig Probleme, da kann man sich austauschen. Die nächste Eskalationsstufe im Vertikalsystem ist der Basic-Talk.
[42:30]Basic-Talk kann vernichtende Konsequenzen haben und Basic-Talk ist nun mal tatsächlich nur Basic. Das ist alles unter zehn Wörtern, keine Fremdwörter, keine Relativsätze. Es muss auch gar nicht sachlich sein. Sie sagen irgendwas, dann sagt die andere Seite, versteht niemand. Dann sagen Sie nochmal irgendwas, dann sagt die andere Seite, können Sie jemand anderem erzählen. Dann sagen Sie nochmal ein Argument, dann sagt die andere Seite, nö. Ich habe gerade so eine Liste im Kopf von die zehn Totschlagargumente von Hochstaplern und wie können sie darauf reagieren inhaltlich. Ich muss das nur identifizieren, dass hier gerade eine Eskalation stattfindet.
[43:10]Aber Basic Talk ist erst die zweite Eskalationsebene. Es gibt noch eine drüber und die kann Leute total kaputt machen, wenn sie nicht damit umgehen können. Und das ist eben dieser erwähnte Move-Talk. Der kann ungeheuer mächtig sein. Und wenn jemand Move-Talk macht, vielleicht sogar verbunden mit einem Basic-Talk und auf der anderen Seite sitzt jemand, der kann nur, nur in Anführungszeichen, der kann nur argumentieren, der kann nur inhaltlich detailliert vorgehen, dann wird diese Person in der Sekunde, wo die andere Seite Basic-Talk und Move-Talk einsetzt, dann hat die wenig Chancen. Das heißt, ich kann auch auf diese Ebenen gehen, aber nicht, weil das so ein tolles Spiel ist, sondern weil, wenn ich auf derselben Ebene antworte, dann ist die andere Seite auch bereit, wieder zurückzugehen und inhaltlich werden. Und Herr Mottler, das würde ich mit Ihnen gerne in einer nächsten Folge nochmal vertiefen. Und zwar, weil Sie ein hochinteressantes Buch zum Thema Moderieren von Köln.
[44:11]Schwierigen Gesprächen von diesen unterschiedlichen Kommunikationstypen auch geschrieben haben. Und wo das eine Rolle spielt, dass wir darauf eingehen können, gerade in der Moderatorenrolle auch, dass die beiden Kommunikationssysteme zueinander finden und sich nicht ständig weiter polarisieren.
[44:31]Oder eben aneinander vorbeireden. Gerne, Herr Weigel, gerne. Wir sind nämlich für heute am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich fand es hochinteressant, nochmal mit Ihnen sozusagen direkt sprechen zu können und die Feinheiten der Botschaften herauszuarbeiten, weil ich den Eindruck habe, dass wirklich.
[44:50]Wenn man in einem System sich sehr zu Hause fühlt, sodass das andere wie in eine ferne Erinnerung oder als gar nicht real wahrgenommen wird, dass man einfach die Botschaften tatsächlich aus den Augen verliert und denkt, das ist eine Absage an ein Miteinander. Das ist es sehr oft nicht. Da würde ich auch dann im nächsten Gespräch vielleicht noch ein paar Beispiele auch mitbekommen, wie das sich anhört oder anfühlt, wenn diese beiden zueinander gefunden haben, weil man die Eintrittskarten regulär und vollständig bezahlt hat. Ja, gern, Herr Weigel. Herr Modler, ich wünsche Ihnen einen schönen Arbeitstag mit allen Kommunikationssystemen, die Ihnen so entgegen flattern und freue mich auf ein nächstes Gespräch mit Ihnen. Danke, Herr Weigel. Ich freue mich auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Dr. Peter Modler zum horizontalen und zum vertikalen Kommunikationssystem und wie man die richtige Eintrittskarte zum richtigen Zeitpunkt auch einlöst. Und dann sollte es gelingen. Wir werden das vertiefen in einer zweiten Episode.
[45:59]Und darauf freue ich mich schon. Ebenso wie ich mich gefreut habe, dass du und ihr wieder hier mit dabei wart. Und wenn dir das gefallen hat, der Podcast und diese Episode, dann hinterlasst doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast oder Google Business. Empfiehlt dem Podcast weiter und abonniere ihn, wenn du das noch nicht getan hast. Bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige., dein Host von INKOVEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.
- Das Arroganz-Prinzip: So haben Frauen mehr Erfolg im Beruf“ (Erstveröffentlichung 2009, überarbeitete Neuauflage 2018): In diesem Bestseller stellt Modler die Erfahrungen aus seinen Arroganz-Trainings® für Frauen dar und bietet Werkzeuge, um sich im beruflichen Umfeld besser durchzusetzen.
- Die freundliche Feindin: Weibliche Machtstrategien im Beruf (2018): Dieses Buch beleuchtet die subtilen Machtstrategien, die Frauen im Berufsleben anwenden, und gibt Einblicke, wie man ihnen begegnen kann.
- Mit Ignoranten sprechen: Wer nur argumentiert, verliert (2019): Modler analysiert Situationen, in denen Machtspieler die Oberhand haben, und formuliert zehn konkrete Widerstandsregeln, um sich gegen Ignoranz zu wappnen.
- Wenn Höflichkeit reinhaut: Moderation als Kampfkunst (2022): Hier präsentiert Modler die »Kampfkunst« einer durchsetzungsstarken Höflichkeit und zeigt, wie man Diskussionen effektiv moderiert und den Diskussionsraum gestaltet und schützt.
- Die Manipulationsfalle: Selbstbewusst im Beruf mit dem Arroganz-Training® für Frauen: Dieses Werk bietet Frauen Strategien, um Manipulationen im Berufsalltag zu erkennen und selbstbewusst zu begegnen.
- Die Königsstrategie: So meistern Männer berufliche Krisen: Modler gibt Männern Ratschläge, wie sie berufliche Krisen erfolgreich bewältigen können.
- Macht. Wie du sie anwendest, auch wenn du von ihr nichts wissen willst (erscheint am 20. Februar 2025): In diesem Buch nimmt Modler konkrete Machtfragen im Joballtag unter die Lupe und plädiert für eine bewusste und gelassene Anwendung von Macht.
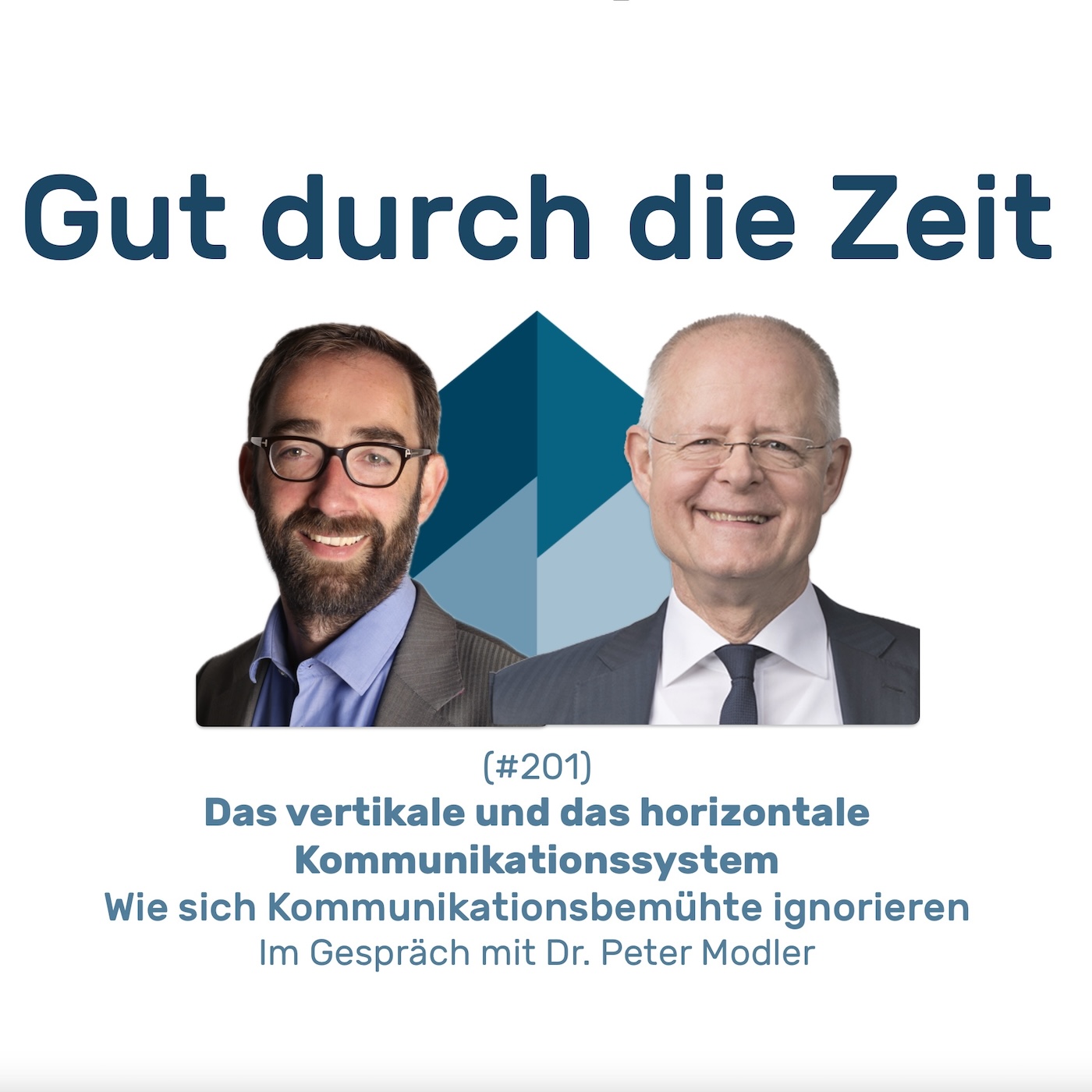


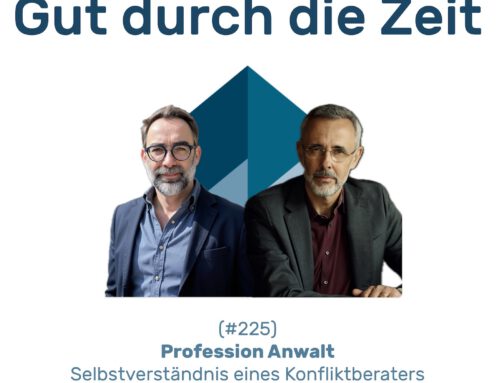
Hinterlasse einen Kommentar