INKOVEMA-Podcast „Gut durch die Zeit“
#235 GddZ
Kooperation
Was ist aus dem Dritten Weg geworden?
Im Gespräch mit Prof. Guido Möllering
Promoviert 2003 an der Universität Cambridge und habilitiert 2011 an der Freien Universität Berlin.
Ist seit 2016 Direktor und Lehrstuhlinhaber am Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung (RMI) an der Universität Witten/Herdecke.
Zu den inhaltlichen Schwerpunkten des RMI unter seiner Leitung zählen unter anderem: Kooperative Beziehungen, Netzwerk- und Allianzstrategien, Management von Offenheit und Transparenz, Vertrauen in und zwischen Organisationen, neue Führungs- und Arbeitsformen im digitalen Zeitalter sowie unternehmerische Verantwortung.
Guido Möllering hat in führenden Fachzeitschriften publiziert und ist u.a. Autor der Bücher Trust: Reason, Routine, Reflexivity (2006) und Produktion in Netzwerken (mit Jörg Sydow, 3. Aufl., 2015). 2009 erhielt er von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften den Preis der Peregrinus-Stiftung für seine für Wirtschaft und Gesellschaft bedeutsamen Arbeiten. Seit 2018 ist er Mitglied der Jury des Wettbewerbs für Unternehmensverantwortung „Mein gutes Beispiel“.
Kooperation statt Konfrontation!
Konfrontation für Kooperation?
Kleine Reihe: Kooperation
Einigkeit?
Mitnichten ist für Kooperationsprozesse ein Ziel und ein Interesse auf allen Seiten nötig?
Abgestimmtheit?
Inhalt
Kapitel:
0:03 Einleitung zum Thema Gewalt
1:33 Der Weg zur Resilienz
4:36 Dunkelziffer und öffentliche Wahrnehmung
6:40 Erfahrungen von Betroffenen
9:16 Der Einfluss von Institutionen
11:46 Gewalt als gesamtgesellschaftliches Phänomen
14:16 Die Rolle der Medien
17:12 Mediation als Lösungsansatz
19:52 Die Notwendigkeit von Begleitung
22:07 Herausforderungen für Betroffene
24:29 Die Stille der Schweigenden
25:38 Biografische Perspektiven
27:36 Die Rolle der Mediation
34:01 Der Dialog mit Institutionen
36:40 Mediatoren als Begleiter
41:39 Fazit und Ausblick
Inhaltliche Zusammenfassung
In dieser Episode starte ich gemeinsam mit meinem Gesprächspartner, Prof. Dr. Guido Möllering vom Reinhard-Mohn-Institut in Witten, eine neue Reihe, die sich zentral mit dem Thema Kooperation beschäftigt. Wir beleuchten die wieder aufkeimende konfrontative Art in verschiedenen Lebensbereichen und reflektieren, warum Kooperation trotz alles Herausforderungen eine notwendige Grundlage in der Konfliktbewältigung bleibt. Durch unsere Diskussion möchten wir ein tieferes Verständnis für die Konzepte von Kooperation, Vertrauen und deren Rollen in unterschiedlichen organisatorischen und gesellschaftlichen Kontexten entwickeln.
Zu Beginn der Episode werfen wir einen Blick auf die Evolution des Kooperationsbegriffs, den ich während meines Studiums und meiner Promotionszeit intensiv erforscht habe. Hierbei untersuchen wir, wie sich die Vorstellung von Kooperation über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat, insbesondere im Kontext der Ökonomie und der Organisationslehre. Wir diskutieren die Möglichkeit, dass Kooperation als dritte Organisationsform neben Markt und Hierarchie auftritt, wobei diese Form oftmals Freiwilligkeit und gegenseitige Abhängigkeit mit sich bringt. Es wird klar, dass die Förderung von Kooperation oft an spezifische Bedingungen gekoppelt ist, die in der komplexen Realität jedoch nicht immer gegeben sind.
Durch Beispiele aus der Praxis und aktuelle Entwicklungen reflektieren wir bestehende Herausforderungen, die mit kooperativen Prozessen einhergehen. Dabei wird uns bewusst, dass trotz der theoretischen Fundierung und der vielen positiven Beispiele für gelungene Kooperationen in der Realität oft die Situationen überwiegen, in denen Kooperation scheitert. Während wir uns mit den Gelingens- und Misslingensfaktoren der Kooperation auseinandersetzen, entsteht eine wertvolle Diskussion darüber, inwiefern die ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen das kooperative Handeln beeinflussen.
Ein zentraler Punkt in unserem Gespräch ist die Differenzierung zwischen Kooperation und Konfrontation, die in den letzten Jahren zunehmend zu beobachten war. Wir fragen uns, ob diese Konfrontation als strategisches Mittel eingesetzt wird, um letztlich doch zu einer Art von Kooperation zu gelangen, oder ob sie gar destruktive Ausmaße annimmt, die jegliche Form von konstruktivem Dialog unmöglich machen. Dabei kommt auch der Rolle der Macht und des Vertrauens eine tragende Bedeutung zu, die wir in Bezug auf aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklungen analysieren.
Abschließend stellen wir die Frage, wie es gelingen kann, die Prinzipien der Kooperation wieder stärker in unsere Organisationen und zwischenmenschlichen Beziehungen zu integrieren. Wir sind uns einig, dass in der kommenden Reihe zahlreiche facettenreiche Aspekte von Kooperation behandelt werden müssen, um nicht nur theoretische Analysen, sondern auch praktische Lösungsvorschläge zu entwickeln. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Episode, in der wir detaillierter auf die Strukturelemente eingehen werden, die für eine erfolgreiche Kooperation entscheidend sind.
Die Frage ist doch vielmehr, wie Konfrontation der Kooperation dienen kann!Kooperationen in der Wirtschaft in Form von Joint Ventures gelang nur selten erfolgreich.
Vollständige Transkription



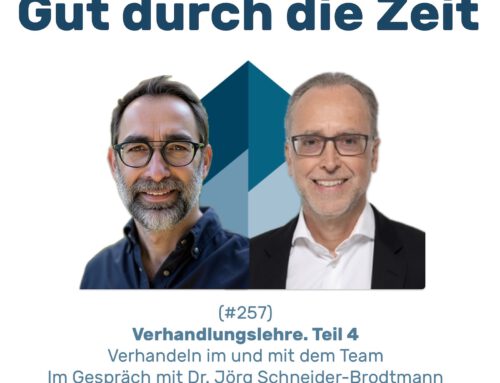

Hinterlasse einen Kommentar