INKOVEMA-Podcast „Gut durch die Zeit“
#242 GddZ
Mediation in Schulen
Wie kommt denn Mediation im Kontext Schule überhaupt zustande?
Im Gespräch mit Kerstin Lück
Mediatorin und Trainerin für Konfliktmanagement, studierte Germanistik, Psychologie und Religionswissenschaften. Seit 1995 ist sie als Mediatorin tätig, seit 2005 selbstständig und bildet seit 2005 auch andere Personen in Mediation (vor allem für den Kontext Schule) aus.
Kleine Reihe: Mediationsfelder
Inhalt
Kapitel:
ausführliche Zusammenfassung
In dieser Episode des Podcasts „Gut durch die Zeit“ stehen die Herausforderungen und Chancen der Mediation im schulischen Kontext im Fokus. Als Gastgeber spricht Sascha Weigel mit der erfahrenen Mediatorin Kerstin Lück, die über 30 Jahre Erfahrung in der Mediation mitbringt. Die Diskussion beleuchtet das oft konfliktreiche Umfeld Schule, in dem das Verhältnis zwischen Lehrkräften, Eltern und Schülern eine zentrale Rolle spielt. Kerstin bringt nicht nur ihre praktischen Erfahrungen ein, sondern auch ihre Erkenntnisse aus der Forschung und Publikationen zu diesem Thema.
Kerstin erläutert, wie sich die Schulmediation von anderen Bereichen unterscheidet, und beschreibt die spezifischen Konfliktlinien, die in Schulen vorherrschen. Sie hebt hervor, dass Konflikte oft im Verborgenen stattfinden, seien es Spannungen zwischen Eltern und Lehrkräften oder interne Differenzen zwischen Kolleginnen und Kollegen. Ein zentrales Anliegen ist es für sie, dass Schulen ernsthafte Mechanismen zur Konfliktlösung implementieren, die nicht nur auf die Schüler fokussiert sind, sondern auch die Bedürfnisse der Erwachsenen in der Schule reflektieren.
Ein besonderer Aspekt, den die beiden besprechen, ist die Rolle der Eltern im Konfliktgeschehen. Kerstin thematisiert die Stressfaktoren, die Eltern und Lehrkräfte beim Austausch belasten, und beleuchtet, wie Vorurteile und Missverständnisse die Kommunikation erschweren. Gleichzeitig erkennt sie die Notwendigkeit, dass Schulen den Eltern mehr Einblicke in den Schulalltag geben und sie stärker in Entscheidungsprozesse einbeziehen sollten. Diese Herausforderungen vertiefen sich zusätzlich, wenn interkulturelle Aspekte ins Spiel kommen, denn die Diversität der Schülerschaft bringt oft eigene Konflikte mit sich, die – wie von Kerstin beschrieben – nicht immer angesprochen werden.
Kerstin betont, dass es wichtig ist, Räume für diesen Austausch zu schaffen, um Schülern und Eltern zu ermöglichen, ihre Probleme offen zu diskutieren und Lösungen zu finden. Dabei spielt auch die Ausbildung von SchülermediatorInnen eine zentrale Rolle, um ein Bewusstsein für Konfliktlösungsprozesse zu schaffen. Ein interessantes Tool, das sie vorstellt, ist der „Friedensteppich“, der den Schülern helfen soll, ihre Konflikte eigenständig zu lösen, ohne dabei auf Erwachsene angewiesen zu sein.
Abschließend gibt es einen Ausblick auf die Möglichkeiten, wie die Mediation in Schulen institutionalisiert werden könnte, um sowohl Lehrer als auch Schüler langfristig zu unterstützen. Kerstin ist überzeugt davon, dass eine gesetzliche Verankerung von Mediation im schulischen Alltag ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung wäre. Der Podcast bietet somit einen umfassenden Einblick in die dynamischen Herausforderungen der Mediation im schulischen Bereich und regt zum Nachdenken über neue Ansätze an.
Vollständige Transkription
(KI-generiert)


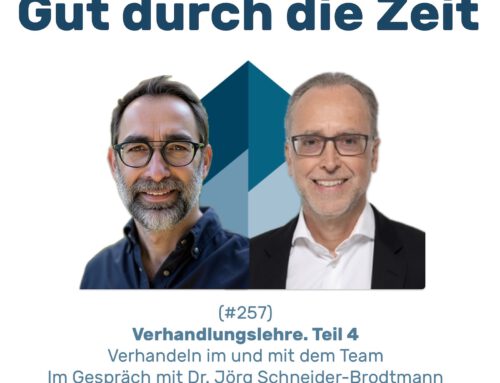


Hinterlasse einen Kommentar