INKOVEMA-Podcast „Gut durch die Zeit“
#238 GddZ
Konfliktfeld Kommune – Konfliktmanagerin Kommune
Kommunen als Wirkungsfeld gesellschaftlicher Konflikte, mit denen sie einen konstruktiven Umgang finden müssen.
Im Gespräch mit Prof. Beate Küpper und Dr. Sonja Fücker
Sonja Fücker ist Soziologin und Mediatorin. Sie leitet den Arbeitsbereich »Kommunale Konfliktbearbeitung« an der Konfliktakademie ConflictA der Universität Bielefeld. Als freiberufliche Mediatorin begleitet sie Verständigungsprozesse in Wissenschaftsorganisationen und kommunalen Einrichtungen. Ehrenamtlich begleitet sie bei dem Verein Täter-Opfer-Ausgleich Bremen e. V. Mediations- und Schlichtungsverfahren.
Prof. Dr. Beate Küpper Hochschule Niederrhein Fachbereich Sozialwesen SO.CON Social Concepts, Institut für Forschung und Entwicklung in der Sozialen Arbeit, Sozialpsychologin, externes Mitglied im Direktorium der Konfliktakademie ConflictA an der Universität Bielefeld, arbeitet zu Diversität, Rechtspopulismus, und Rechtsextremismus sowie lokalen Konflikten und ihrer Bearbeitung.
Kleine Reihe: Beiträge aus der Konfliktdynamik. Teil 6
Inhalt
Kapitel:
ausführliche Zusammenfassung
In dieser Episode beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema Konflikte in Kommunen und deren Dynamiken. Ich habe zwei hochqualifizierte Gäste eingeladen: Frau Professorin Beate Küpper und Frau Doktorin Sonja Fücker. Ziel der Diskussion ist es, die Kommunen als Konfliktfelder zu betrachten, sowohl als Schauplatz als auch als entscheidenden Akteur in der Konfliktbearbeitung.
Zunächst bringen wir die Perspektive der Wissenschaftlerinnen ein, die beide über umfangreiche Erfahrungen in der sozialpsychologischen Forschung und in der praktischen Konfliktbearbeitung verfügen. Beate Küpper erläutert, dass Konflikte in der Gesellschaft oft von lokalen Herausforderungen ausgehen, wie etwa baulichen Veränderungen oder sozialen Integrationsfragen. Durch die Erweiterung von lokalem zu globalem Level, wird die Wahrnehmung von Konflikten besonders stark beeinflusst. Sonja Fücker ergänzt, dass man häufig beobachten kann, dass lokale Konflikte, wie nachbarschaftliche Auseinandersetzungen, schnell in größer angelegte gesellschaftliche Debatten münden.
Es wird deutlich, dass die Wahrnehmung von Konflikten je nach Akteur variiert. Während die Bürger oft lokale Probleme als bedeutend empfinden, zeigen Umfragen unter Experten eine Schwerpunktverlagerung hinzu sozialen Ungleichheiten. Diese Diskrepanz wird als zentrale Herausforderung für die Konfliktbearbeitung in Kommunen identifiziert. Das Ergebnis ist nicht nur, dass Kommunen als Adressaten von Konflikten agieren, sondern sie auch selbst als potenzielle Verursacher oder als aktive Akteure in diesen Konfliktdynamiken fungieren.
Der Dialog schwenkt zu den konkreten Methoden der Konfliktbearbeitung innerhalb der kommunalen Strukturen. Es wird diskutiert, dass erfolgreiche Konfliktlösungen nicht nur von der Professionalisierung der Beteiligten abhängen, sondern auch von der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und reflexiv mit den eigenen Perspektiven umzugehen. Dies zeigt sich in der Notwendigkeit, verschiedene Sichtweisen auf Konflikte zu integrieren, um einen breit angelegten Dialog zu fördern.
Die Tatsache, dass viele Bürgerinnen und Bürger ein großes Mitbestimmungsinteresse haben, aber in der Praxis oft nicht aktiv werden, wird kritisch betrachtet. Der Spannungsbogen zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der politischen Mitgestaltung wird deutlich, insbesondere vor dem Hintergrund des zunehmenden Populismus. Populistische Narrative prägen oft die Wahrnehmung von Konflikten und verzerren die Auseinandersetzung mit den eigentlichen Problemen.
Wir beleuchten auch die Bedeutung von Schutzkonzepten für diejenigen, die in Kommunen aktiv an Konfliktlösungen arbeiten. Diese Sichtweise stellt die Verantwortung nicht nur auf individuelle Akteure, sondern auch auf die institutionellen Strukturen, die die Rahmenbedingungen für konfliktbewusstes Handeln schaffen müssen.
Abschließend reflektieren wir über die Notwendigkeit der Professionalisierung in der Konfliktbearbeitung und die Möglichkeiten, die Kommunen haben, um in einer zunehmend komplexen sozialen Umwelt handlungsfähig zu bleiben. Verlinkungen zu den Arbeiten von Küpper und Fücker, die die theoretischen und praktischen Aspekte des kommunalen Konfliktmanagements vertiefen, runden das Gespräch ab. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erhalten somit einen umfassenden Einblick in die vielschichtigen Herausforderungen und Dynamiken, mit denen Kommunen konfrontiert sind.
Vollständige Transkription
(KI-generiert)




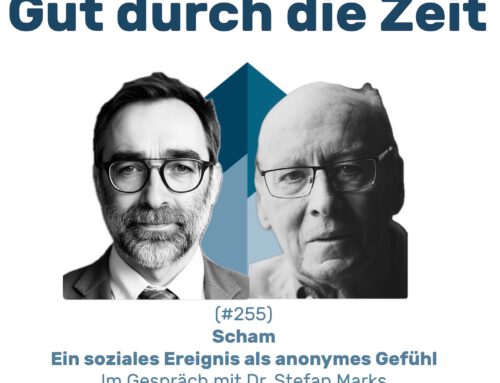
Hinterlasse einen Kommentar