INKOVEMA-Podcast „Gut durch die Zeit“
#219 GddZ
Vertrauen.
Teil 3 – Der Preis des Vertrauens
Nachteile, Risiken, Schattenseiten
Im Gespräch mit Prof. Dr. Guido Möllering
Prof. Dr. Guido Möllering, promovierte 2003 an der Universität Cambridge und habilitierte 2011 an der Freien Universität Berlin, ist seit 2016 Direktor und Lehrstuhlinhaber am Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung (RMI) an der Universität Witten/Herdecke. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten des RMI unter seiner Leitung zählen unter anderem: Kooperative Beziehungen, Netzwerk- und Allianzstrategien, Management von Offenheit und Transparenz, Vertrauen in und zwischen Organisationen, neue Führungs- und Arbeitsformen im digitalen Zeitalter sowie unternehmerische Verantwortung.
- Trust: Reason, Routine, Reflexivity (2006)
- Produktion in Netzwerken (mit Jörg Sydow, 3. Aufl., 2015).
Kleine Reihe: Vertrauen
Inhalt
Kapitel
0:03 Einführung in das Thema Vertrauen
1:57 Risiken und Schattenseiten des Vertrauens
8:01 Täuschung und Enttäuschung
9:58 Vertrauen und soziale Dynamiken
16:16 Vertrauen in Beziehungen
22:22 Vertrauen und Druck im Arbeitskontext
26:18 Gutmütigkeit und blinder Vertrauen
32:48 Vertrauen und Verlustaversion
36:51 Identität und Vertrauen
40:51 Vertrauen und Reputation
43:59 Reflexion über Vertrauen
47:34 Blinder Glaube und Skepsis
49:52 Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassung
In dieser Episode des Podcasts „Gut durch die Zeit“ beleuchte ich gemeinsam mit Prof. Dr. Guido Möllering die Risiken und Schattenseiten des Vertrauens – das dritte und abschließende Thema in unserer Reihe, die mit den Episoden #169 und #172 begonnen hat.
Zuerst werfen wir einen Blick darauf, was wir in früheren Folgen zum Begriff des Vertrauens besprochen haben und was es für soziale Interaktionen bedeutet. Vertrauen ist eine komplexe Annahme, die sowohl positive als auch negative Implikationen mit sich bringt. Es erlaubt uns, Unsicherheiten zu reduzieren und soziale Beziehungen zu stärken, es kann jedoch auch zu Enttäuschungen führen.
Wir diskutieren, wie Vertrauen wie ein Beruhigungsmittel wirkt, das uns vor der unschönen Realität von Unsicherheit und Verwundbarkeit bewahrt. Diese Metapher illustriert, dass übermäßiges Vertrauen auch zur Abhängigkeit führen kann und den Blick für (potenziell) negative Aspekte einer Beziehungs- bzw. Lebensgestaltung vernebelt. Dabei ist es wichtig, die beiden Gesichter des Vertrauens zu betrachten: Das eine ist die nützliche Komponente des Vertrauens, die uns verbindet und Handlungsspielräume eröffnet. Das andere ist die potenzielle Gefahr der (Selbst-)Täuschung und unangemessenen Beruhigung – etwa durch Wegschauen, Verdrängen oder gar Manipulation und Missbrauch.
Ein zentrales Thema unserer Diskussion ist das Phänomen des blinden Vertrauens, das uns auch blind für Warnsignale macht. Hier beleuchten wir, wie Menschen in vertrauensvollen Beziehungen oft geneigt sind, kleine Anzeichen von Misstrauen zu ignorieren, was schließlich zu großen Konflikten führen kann. Wir sprechen ebenfalls über die Dynamik in Beziehungen, in denen Vertrauen führt, jedoch auch Druck auf die Beteiligten ausübt – zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter mit übermäßigen Erwartungen konfrontiert wird, weil ihm in der Vergangenheit viel Vertrauen entgegengebracht wurde.
Außerdem thematisieren wir die soziale Macht, die durch Vertrauen ausgeübt werden kann. Dabei zeigen wir auf, wie Erwartungen, die mit Vertrauen verbunden sind, als Druckinstrument missbraucht werden können. Dies kann zu einem Teufelskreis führen, in dem man sich nicht mehr traut, in einer Beziehung Zweifel zu äußern, aus Angst, das Vertrauen zu enttäuschen oder, schlimmer noch, die Beziehung zu gefährden.
Für uns war es also wichtig, den sozialen Preis von Vertrauen zu erkunden und darüber nachzudenken, wann Vertrauen positiv oder negativ genutzt wird. Wir reflektieren auch, was Vertrauen in sozialen und geschäftlichen Zusammenhängen bewirken kann und in welchen Fällen es uns zum Nachteil gereicht. Der Zuhörer wird dazu angeregt, ein Gespür für die komplexen Beziehungen zwischen Vertrauen, Macht und Verantwortung zu entwickeln.
Die ganze Episode ist ein spannender Austausch über die Nuancen des Vertrauens und die Balance, die in zwischenmenschlichen Beziehungen gewahrt werden muss. Soziale Interaktionen sind geprägt von einem ständigen Abwägen zwischen Vertrauen und Vorsicht, was auch in einem unternehmerischen Kontext von großer Bedeutung ist. Wir laden die Zuhörer ein, über ihre eigenen Erfahrungen nachzudenken und was Vertrauen für sie in ihren Beziehungen bedeutet.
Vollständige Transkription




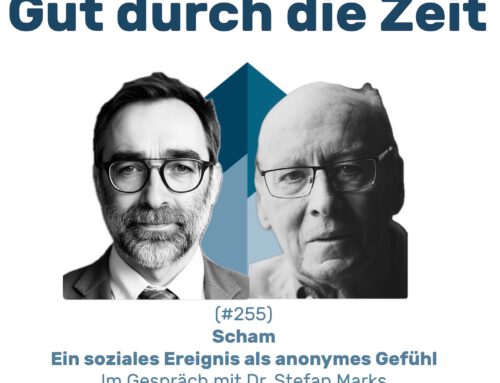
Hinterlasse einen Kommentar